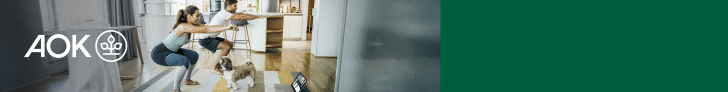- Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
- Erster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
- Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
- Weihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
- Drill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
- Koala-Baby lüftet das Geheimnis seines Beutels – Einzigartige Einblicke pünktlich zu Halloween!
- Elefantenrettung mit Hightech-Medizin: Wie Akito seinen Stoßzahn (fast) verlor – und doch behielt!
- Wildtierspuren zwischen Afrika und Augsburg: Erleben Sie faszinierende Einblicke hinter die Kulissen des Artenschutzes!
- Zootag im Augsburger Zoo
- Tolle Zuchterfolge im Neunkircher Zoo
- Redaktion
Bereits vor zwei Monaten kamen zwei Nacktnasenwombats in die Wilhelma Stuttgart. Nach einer mehrwöchigen Quarantäne und Eingewöhnungszeit hinter den Kulissen, ist es nun so weit: Wendy und Windemer sind ab sofort für die Besucher des Zoologisch-Botanischen Gartens Stuttgart zu sehen.
Wendy stammt aus dem Budapester Zoo, Windemere ist eine Nachzucht aus einem Tierpark in Tasmanien. Sie gehören zur Unterart der Tasmanischen Nacktnasenwombats und sind beide dreieinhalb Jahre alt. Nun finden sie in der extra für sie umgebauten ehemaligen Zebramangustenanlage neben den Seelöwen ein Zuhause.
Später werden die beiden Wombats in die Tasmanien-Anlage übersiedeln, die zwischen der Terra Australis und dem Amazonienhaus entstehen soll. Die Eröffnung der begehbaren Anlage für Wombats, Graue Riesenkängurus und Bennettkängurus ist für 2025 geplant.
Wegen ihres gedrungenen Aussehens, das die Verwandtschaft mit den Kängurus kaum erahnen lässt, tragen Wombats in unserer Sprache den wenig schmeichelhaften Namen Plumpbeutler – mit den kurzen Beinen und dem Stummelschwänzchen sehen sie ein bisschen aus wie kleine Bären. Wombats werden etwa einen Meter lang und können bis zu 50 Kilo auf die Waage bringen. Sie leben im Süden des australischen Kontinents und auf Tasmanien.
Wie viele Beuteltiere ist auch der Nacktnasenwombat meist dämmerungsaktiv. „Die nun in der Wilhelma lebende Unterart kommt zudem mit kühlen Temperaturen in unseren Wintermonaten sehr gut zurecht“, betont sagt Volker Grün, Leiter des Fachbereichs Zoologie. „In ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet auf Tasmanien kann im Winter durchaus Schnee fallen.“
Die Wilhelma ist neben den Zoos in Duisburg und Hannover der Dritte in Deutschland, in dem Nacktnasenwombats zu sehen sind. Sie bilden einen Teil der europäischen Reservepopulation für diese faszinierende Beuteltierart.
Die kuriosen würfelförmigen Hinterlassenschaften der Wombats haben sogar das Interesse der Wissenschaft geweckt. Vor fünf Jahren ist eine amerikanisch-australische Forschergruppe der Frage nach dem Warum nachgegangen: Der Kot diene der Reviermarkierung, die Würfelform soll angeblich verhindern, dass die anrüchige Markierung von höheren Stellen herunterrollt, so deren Erkenntnis.
Dafür bekamen die Forscher 2019 den Ig-Nobelpreis verliehen – eine Art Anti-Nobelpreis, eine satirische Auszeichnung für wissenschaftliche Leistungen, „die Menschen erst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringen“, so die Jury, der auch verschiedene „echte“ Nobelpreisträger angehören.
„Neben Koalas und Quokkas sind Wombats sicher die beliebtesten Tiere Australiens“, sagt Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Wendy und Windemere eine weitere spektakuläre Tierart in der Wilhelma zeigen und damit unseren Besucherinnen und Besucher das entfernte Australien etwas näherbringen können.“
Auf dem Foto ist ein Nacktnasenwombat in der extra für ihn umgestalteten Anlage zu sehen.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Die 22 Jahre alte Giraffenkuh „Ashanti“ wurde am Mittwochmorgen, 29. November 2023, vom Veterinärteam des Leipiger Zoos erlöst. Vorausgegangen war ein sich seit Monaten erschlechternder Allgemeinzustand, der durch verminderte Nahrungsaufnahme und infolgedessen massiven Muskelabbau hervorgerufen wurde.
„In unserer Verantwortung liegt es, durch intensives Monitoring das Leiden bei alten Tieren auf ein absolutes Minimum zu beschränken, alle pflegerischen und medizinischen Möglichkeiten auszuschöpfen und wenn es geboten ist, im richtigen Moment die Entscheidung im Sinne des Tieres zu treffen. Aufgrund ihres schlechten körperlichen Zustandes war es nicht mehr vertretbar, unser Eingreifen weiter hinauszuschieben. Ashanti konnte kaum mehr richtige Nahrung aufnehmen oder verwerten und zeigte in letzter Zeit einen zunehmenden körperlichen Verfall“, erklärt Zootierarzt Dr. Andreas Bernhard.
Er war es auch, der heute die Euthanasie von Ashanti, die in den letzten Monaten intensiv
veterinärmedizinisch und durch die Pfleger betreut wurde, durchgeführt hat.
Ashanti war mit ihren 22 Jahren die älteste Giraffe in der Leipziger Herde, kam im Jahr 2003 aus dem Zoo Ostrava nach Leipzig und sorgte zusammen mit dem im Jahr 2020 verstorbenen Giraffenbullen Max für fünf Jungtiere.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Erneuter Zugang im Koala-Haus: Am Montagnachmittag traf das zwei Jahre alte Koala-Weibchen Erlinga, das am 15. November 2021 geboren wurde, aus dem Zoo Duisburg auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) wohlbehalten in Leipzig ein, bezog sogleich sein neues Revier im Schaubereich des Hauses und ist ab sofort für die Besucher zu sehen.
„Erlinga hat ihre erste Nacht im neuen Revier, das sie sehr neugierig in Augenschein nahm, gut überstanden und bereits mit Genuss den Leipziger Eukalyptus gefressen. Dies ist immer ein gutes Zeichen und zeigt, dass sich das Tier wohlfühlt“, so Seniorkurator Ariel Jacken.
Mit dem erneuten Transfer sollen die Zuchtbestrebungen des EEPs bei dieser gefährdeten Tierart unterstützt werden. Erst im Sommer dieses Jahres kam das dreijährige Koala-Männchen Yuma aus Duisburg nach Leipzig, das perspektivisch sowohl mit dem sechsjährigen Koala-Weibchen „Mandie“, das bereits in Leipzig im Jahr 2020 erfolgreich ein Jungtier Bouddi aufgezogen hat, als auch mit Erlinga züchten soll.
„Wir unterstützen die Zuchtneuausrichtung des EEPs und hoffen, dass wir an unseren ersten Zuchterfolg anknüpfen und uns mit den beiden Neuzugängen sowie unserem Weibchen Mandie in naher Zukunft über Nachwuchs freuen können. Da das neue Weibchen Erlinga noch nicht im zuchtfähigen Alter ist, richten sich unsere Hoffnungen allerdings zunächst auf Mandie“, erklärt Seniorkurator Ariel Jacken.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
159 tote Flussdelfine innerhalb kurzer Zeit an nur einem See: Das ist die erschreckende Bilanz des Massensterbens, das Ende September 2023 im brasilianischen Amazonasgebiet begonnen hatte. Betroffen sind die ohnehin schon bedrohten Amazonas-Flussdelfine (Inia geoffrensis) und Sotalia-Flussdelfine (Sotalia fluviatilis).
Der Tiergarten der Stadt Nürnberg, die ihm angegliederte Artenschutzgesellschaft YAQU PACHA e. V. und der Verein der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V. haben die Fachleute vor Ort seit Beginn des Massensterbens unterstützt. Sie haben gemeinsam mit Partnern weltweit finanzielle Hilfe in Höhe von 68.000 Euro organisiert – auch dank vieler großzügiger Spenden – sowie tiermedizinische und
technische Unterstützung für den Einsatz koordiniert.
Seit Beginn der Umweltkatastrophe ist die Forschungsgruppe für aquatische Säugetiere im Amazonasgebiet vom Institut Mamirauá gemeinsam mit ICM-Bio-Tefé, einem Institut für die Erhaltung der biologischen Vielfalt, vor Ort im Einsatz. Neben dem Bergen und Obduzieren toter Delfine arbeiteten sie auch daran, die Ursachen wissenschaftlich zu untersuchen. Ein Zusammenhang mit den Folgen des Klimawandels ist nach den ersten durchgeführten Analysen der erste naheliegende Grund.
Der Höhepunkt des Massensterbens am Tefé-See trat am 28. September 2023 auf, als an einem Tag 70 Delfinkadaver gefunden wurden. Das Institut ICM-Bio rief daraufhin mit technischer Unterstützung des Mamirauá-Instituts und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen einen Umweltnotstand aus. Der Tiergarten und YAQU PACHA haben den Einsatz von diesem Moment an durchgehend unterstützt. Und mit ihnen eine Vielzahl anderer Partner weltweit.
Zum Einsatz gehörten unter anderem die Überwachung der Tiere und der Umweltparameter des Sees. Ein Team überwachte die Delfingruppen entlang des Tefé-Sees an bestimmten strategischen Stellen. Die Forscherinnen und Forscher erfassten nicht nur die Anzahl der Individuen jeder Art, sondern analysierten auch ihr Verhalten. Zeigte ein Tier Auffälligkeiten, stand ein Boot bereit, um es abzutransportieren und zu rehabilitieren. Der Gesundheitszustand der Tiere war meist allerdings so
schlecht, dass sie nicht mehr gerettet werden konnten. Gleichzeitig suchte das Überwachungsteam nach Kadavern, um sie zu sezieren und Proben zu nehmen. Diese werden landesweit in Labore geschickt, um die Ursachen für die Todesfälle zu ermitteln.
Beim Monitoring des Sees konzentrierte sich das Team auf Wasserwerte wie Temperatur, Sauerstoffsättigung, Strömung und den Wasserstand. Auch wenn die Symptome nicht zwangsweise nur auf Hitzestress als Todesursache schließen lassen: Die Trockenheit und eine Wassertemperatur von bis zu 39,1 Grad an einer der überwachten Stellen stehen wahrscheinlich in direktem Zusammenhang mit dem Massensterben. Damit diese Annahme verifiziert werden kann, ist noch eine Vielzahl von Analysen notwendig. Hier hat das Team mit logistischen Schwierigkeiten beim Transport zu Laboren in ganz Brasilien sowie bürokratischen Hindernissen zu kämpfen.
Die Expertinnen und Experten beobachteten im See auch eine vermehrte Ansammlung von Algen, insbesondere der Art Euglena sanguinea, die sich besonders bei hoher Sonneneinstrahlung vermehrt. Obwohl diese Alge potenziell giftig für Fische ist, gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass ihr Gift mit dem Delfinsterben in Verbindung steht.
„Das Massensterben am Tefé-See ist eine Katastrophe für den Artenschutz. Sie verdeutlicht die tiefgreifenden Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt“, sagt Dr. Lorenzo von Fersen, Kurator für Forschung und Artenschutz am Tiergarten Nürnberg und Vorsitzender von YAQU PACHA.
Und er fügte hinzu: „Da sich der Klimawandel weiter verstärken wird, sind Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung und die Zusammenarbeit mit Fachleuten weltweit entscheidend. Nur so können wir mögliche Auswirkungen vorhersagen und entsprechende Strategien entwickeln.“
Kürzlich wurden auch in der Gemeinde Coari in der Nähe von Tefé tote Amazonas- und Sotalia-Flussdelfine entdeckt. Forscherinnen und Forscher haben die dortigen Seen überwacht und bereits 117 Kadaver gefunden. Im Gegensatz zu Tefé dauert in dieser Region das Sterben der Tiere weiterhin an.
Auch dort ist ein Team des Mamirauá-Instituts vor Ort, um die Ursache zu klären. In Tefé ist die Zahl der toten Delfine inzwischen zurückgegangen. Die Beobachtungen werden – wenn auch in reduziertem Umfang – langfristig vom Institut Mamirauá fortgesetzt.
Die Nothilfe ist eine Gemeinschaftsanstrengung eines internationalen Netzwerks vieler Partner: Involviert sind neben YAQU PACHA e. V., dem Tiergarten Nürnberg und dem Verein der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V. unter anderem die National Marine Mammal Foundation (NMMF, USA), der International Fund for Animal Welfare (IFAW), Zoomarine (Portugal), L’Oceanografic (Spanien), Planete Sauvage (Frankreich), die Loro Parque Stiftung (Spanien), die European Association for Aquatic Mammals (EAAM), das Rehabilitationszentrum Mundo Marino (Argentinien) und der
Tierpark Rancho Texas (Spanien).
Sie unterstützen die Teams vor Ort finanziell, aber insbesondere auch mit der Entsendung von Tiermedizinern aus den USA, aus Südamerika und aus Europa, die auf die Versorgung von Delfinen spezialisiert sind. Diese Experten arbeiten überwiegend in zoologischen Gärten und Meereserlebniszentren.
Der Amazonas- und der Sotalia-Flussdelfin gehören zu den weltweit insgesamt fünf Flussdelfinarten. Laut Weltnaturschutzunion IUCN sind alle diese Arten bedroht. Im Amazonasgebiet bringen Überfischung, Kontamination der Gewässer und Abholzung des Regenwalds und die immer weiter vordringende menschliche Infrastruktur, Staudammprojekte und Wasserverschmutzung die Tiere zunehmend in Bedrängnis. Der Bestand von Amazonas-Flussdelfinen im Tefé-See wird auf 900 geschätzt, der der Sotalia-Flussdelfine auf 500.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Goldgelbes Laub säumt die Wege, auf denen ein großer Lastwagen behutsam durch den Tierpark rollt. Als er sich vor den Toren in den Verkehr einfädelt, ahnt hier kaum jemand, dass sich im Inneren des Fahrzeugs neun der größten Landsäugetiere Europas auf wichtiger Mission befinden: Die Rückkehr der einst im natürlichen Lebensraum ausgerotteten Europäischen Wisente gilt als eine der größten Erfolgsgeschichten im internationalen Artenschutz.
Neun Wisente verließen am Dienstag, 21. November 2023. den Tierpark Berlin in Richtung Aserbaidschan, wo sie im 130.508 Hektar großen Shahdag Nationalpark ein neues Zuhause finden werden. Begleitet wurden die Tiere von Experten der Naturschutzorganisation WWF und Tierpark Berlin.
Die Tiere kamen zuvor aus verschiedenen Zoologischen Gärten Europas – unter anderem Schweden, Rumänien, Frankreich und Tschechien – in den Tierpark Berlin, wo sie sich als Herde bereits aneinander gewöhnen konnten. Auch die im Tierpark zur Welt gekommene Wisentkuh Tines gehört zu dieser tierischen Reisegruppe.
Am Flughafen Frankfurt/Hahn treffen die zehn Tiere auf einen weiteren Reisegenossen aus dem Hanauer Wildpark Alte-Fasanerie bevor sie gemeinsam ihre ganz besondere Reise antreten. „Die Geschichte des Wisents gilt als eine der hoffnungsvollsten im modernen Artenschutz, doch noch immer sind Maßnahmen nötig, um die Zukunft des Wisents in der Natur langfristig zu sichern. Ein Schwerpunkt ist dabei der Aufbau größerer Einzelpopulationen und die Verbindung dieser untereinander“, berichtet Christian Kern, Zoologischer Leiter von Zoo und Tierpark Berlin, der die Reise begleitet hat.
„Mit dem erfolgreichen Transport zehn weiterer Tiere schreitet der Rettungsplan für die gefährdete Tierart damit weiter voran“, erklärt er weiter. Bereits seit 2019 setzen sich Zoo und Tierpark Berlin gemeinsam mit dem WWF Deutschland für die Rückkehr des Wisents in seinen natürlichen Lebensraum im Kaukasus ein. Im Rahmen des Wiederansiedlungsprojekts in Aserbaidschan wurden bislang 36 Wisente in der Kernzone des Shahdag Nationalparks ausgewildert.
Die Tiere haben sich bereits vermehrt und der Bestand ist auf 50 angewachsen. Bis 2028 sollen insgesamt 100 Tiere aus europäischen Zoos für den Aufbau einer stabilen Population in Aserbaidschan zur Verfügung gestellt werden.
„Alle zehn Tiere haben die Reise gut überstanden und sind wohlbehalten im Nationalpark angekommen. Die Herde befindet sich nun in einem Eingewöhnungs-Gehege und wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 in die Kernzone des Nationalparks entlassen“, berichtet Aurel Heidelberg, zuständiger Projektleiter und Referent für die Ökoregion Kaukasus beim WWF Deutschland und er fügt hinzu: „Ein solches Projekt ist ein Kraftakt, der nur durch eine langfristige vertrauensvolle Zusammenarbeit von internationalen, nationalen und nicht zuletzt lokalen Partnern geleistet werden kann.“
Neben Aurel Heidelberg und Christian Kern sorgte auch Zoo-Tierarzt Dr. André Schüle dafür, dass es den Tieren unterwegs an nichts fehlte. „Die Geschichte des Europäischen Wisents ist untrennbar mit Berlin verknüpft“, erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem. Noch bevor 1927 der letzte freilebende Wisent im Kaukasus erschossen und die Art im natürlichen Lebensraum ausgerottet wurde, war Berlin die Wiege seiner Wiederauferstehung:
Am 25. und 26. August 1923 trafen sich engagierte Experten im Zoo Berlin, um die „Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents“ zu gründen. „Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Wisentrettung kamen bei uns im Zoo Berlin in diesem Jahr internationale Wisentexpertinnen und -experten zusammen, um diesen schönen Erfolg zu feiern“, fügt er hinzu.
Einst waren Wisente in weiten Teilen Europas zu finden. Doch schrumpfende Lebensräume und Jagd führten bereits ab dem 11. Jahrhundert zum Rückgang der Wisent-Populationen. 1927 wurde dann der letzte Wisent im Kaukasus erschossen. Damit waren die majestätischen Wildrinder in ihrem natürlichen Lebensraum ausgerottet. Nur dank weniger Tiere in der Obhut zoologischer Einrichtungen konnte diese Tierart vor dem endgültigen Aussterben gerettet werden.
Es überlebten jedoch nur 56 Wisente. Die gesamte heutige Wisentpopulation geht auf nur 12 Gründertiere zurück, die aus dem Zoo Berlin, Zoo Frankfurt, Zoo Budapest, Zoo Schönbrunn, Białowieża, Psczyna und dem Kaukasus stammten. Um das weitere Überleben der Art zu sichern, wurde im August 1923 durch die Initiative europäischer Zoodirektoren und Wissenschaftler die „Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents“ im Zoo Berlin gegründet.
Diese gemeinsamen Bemühungen sind somit der Vorläufer der heutigen Erhaltungszuchtprogramme für viele bedrohte Tierarten. Bereits seit 1872 zählen Wisente zum Tierbestand des Zoo Berlin. Auch der Tierpark trägt seit seiner Eröffnung 1955 beachtlich zur Erhaltungszucht der Wisente bei. Bis heute wurden in den Zoologischen Gärten Berlin über 200 Wisente geboren. Der Wisent gilt laut der Weltnaturschutzunion (IUCN) als gefährdete Tierart. Der Wisent-Bestand im natürlichen Lebensraum umfasst heute weltweit wieder 8.225 Tiere – im nächsten Frühjahr kommen elf weitere dazu.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Der fünfjährige Teo kommt aus dem östlich von Paris gelegenen „Parc des félins“ und ersetzt Jaguar Milagro, der Anfang Oktober 2023 in den Rio Safari Park Elche nach Spanien umzog. Nach der erfolgreichen Eingewöhnung ist Teo ab sofort für alle Wilhelma-Besucher zu sehen.
Der neue Kater aus Frankreich ist ein schwarz gefärbter Jaguar. So genannte Schwärzlinge kommen bei Jaguaren immer wieder vor. Ihr Fell ist jedoch nicht vollständig schwarz gefärbt. Bei starkem Lichteinfall kann man die charakteristischen Flecken im schwarz gefärbten Fell erkennen.
Die Wilhelma beteiligt sich an so genannten EAZA Ex-Situ Programmen, dies sind Erhaltungszuchtprogramme des Europäischen Zooverbads (EAZA) und haben den Erhalt von Arten in menschlicher Obhut zum Ziel. Auch für den als potenziell gefährdet eingestuften Jaguar gibt es ein solches Programm.
Jaguarweibchen Taima, die bereits seit vier Jahren im zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart lebt, bekommt mit Teo einen neuen Partner. Zunächst jedoch muss sich der schwarze Neuzugang am Neckar eingewöhnen, bevor er Bekanntschaft mit Taima machen darf, und – so hoffen die Koordinatoren des Erhaltungszuchtprogramms – irgendwann auch für Nachwuchs sorgen wird.
Jaguare leben in Regenwäldern und Buschsavannen des amerikanischen Kontinents, vom Süden der USA bis nach Argetinen, und haben die größte Beißkraft aller Katzen – nicht nur Wasserschweine und Tapire stehen auf ihrem Speiseplan, sondern auch Anakondas und Kaimane, denn wasserscheu sind die amerikanischen Großkatzen nicht. Mit ihrem kräftigen Kiefer können sie sogar den Panzer einer Schildkröte knacken.
Die Einzelgänger, die große Gebiete durchstreifen, werden von der Weltnaturschutzunion IUCN als potenziell gefährdet eingestuft. Vor allem der Verlust und die Zerstückelung ihres Lebensraums macht den geschmeidigen Großkatzen zu schaffen. Deshalb beteiligt sich die Wilhelma nicht nur am Zuchtprogramm, sondern unterstützt auch Projekte im Verbreitungsgebiet der Tiere.
Mit dem Artenschutzeuro, der im Eintrittspreis enthalten ist, wurde der Ankauf von Regenwald in Belize unterstützt. So konnte ein 400 Quadratkilometer großer Regenwaldkorridor, der zwei Naturreservate verbindet, vor der Rodung bewahrt werden. Diese Waldkorridore werden von Jaguaren durchstreift und als Jagdgebiete genutzt.
Das Foto zeigt den neuen Jaguar-Kater in der Wilhelma, der aus einem französischen Zoo kommt und in Stuttgart hoffentlich für Nachwuchs sorgt.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Am 11. November 2023 – pünktlich zum Sessionsauftakt – kam hier ein Banteng (Bos javanicus)-Weibchen zur Welt. Ein echt „kölsch Mädche“, also. Die Tierpfleger haben die jecke Überraschung auf den Namen „Wika“, Javanesisch für „die Siegerin“, getauft. „Wika“ ist seit Anbeginn agil und trinkt regelmäßig die Milch von Mutter „Wangi“.
Das Banteng-Kälbchen ist bereits häufig gut sichtbar für die Zoo-Gäste im Außenbereich der Anlage unterwegs. Vater ist Bulle „Buddy“. Er kam aus dem Zoologischen Garten Berlin nach Köln. „Buddy“ ist ein imposantes Tier mit typisch schwarzer Fellfarbe. Die rotbraun gefärbte Mutter „Wangi“ stammt aus dem Zoo Dresden. „Wika“ ist „Wangis“ sechstes Jungtier – und ihr erstes weibliches.
Bantengs sind bedrohte asiatische Wildrinder. Sie leben unter anderem auf den großen Inseln Indonesiens. Die Weltnaturschutzorganisation IUCN stuft den wilden Banteng als „stark gefährdet“ ein. Der Bestand wird heute auf noch 4.000 bis 8.000 Tiere geschätzt – allerdings in vielen kleinen, verstreuten Populationen. Tendenz abnehmend.
Hauptursachen für den Rückgang sind Lebensraumzerstörung, die Einkreuzung von Hausrindern sowie Viehkrankheiten, die von Hausrindern übertragen werden. Der Kölner Zoo engagiert sich im Rahmen des „Action Indonesia“-Programms für Banteng-Schutzprojekte vor Ort. Auf der 2017 eröffneten Anlage leben die Bantengs seit Kurzem zusammen mit einem Prinz-Alfred-Hirsch-Paar, einer südostasiatischen Hirschart, die ebenfalls stark gefährdet ist. Auch hier strebt der Kölner Zoo Nachzuchten an.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Was wünschen sich Tierpfleger für die Zootiere? Was könnte man den Tieren zusätzlich als spannende Beschäftigung anbieten? Darüber haben sich die Tierpfleger im Zoo Heidelberg Gedanken gemacht, sodass rechtzeitig vor Weihnachten wieder die beliebte Wunschliste für Zootiere fertig gestellt wurde.
Die Geschenkideen umfassen neben nützlichen Pflegeutensilien auch zahlreiche Ideen für das tägliche Training. Wer den Tieren im Zoo Heidelberg eine Freude machen möchte, kann die benötigten Artikel ab sofort in der Wunschliste aussuchen und online bestellen auf www.zoo-heidelberg.de/wunschliste
Es gibt vieles, was man zu Weihnachten verschenken kann. Warum nicht einmal den Tieren im Zoo Heidelberg etwas Gutes tun? Für Zoodirektor Dr. Kaus Wünnemann und sein Team ist es eine schöne Tradition, den Tieren vor Weihnachten eine Freude zu bereiten. Auf der Wunschliste steht eine Vielzahl an Dingen. Einige Artikel erscheinen auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich. Schaut man genauer auf die Beschreibung, wird klar: Viele Wünsche dienen der täglichen Beschäftigung.
So zum Beispiel Futterbälle, die mit Snacks gefüllt werden können. Um an das Futter zu gelangen, müssen sich die Tiere dies zunächst „erarbeiten“ und hier ihre Fähigkeiten geschickt einsetzen. Die „kleinen Räuber“, wie Erdmännchen, Goldkatzen oder Fossas, freuen sich über dieses spannende Intelligenzspielzeug. Genauso wie die Affen, die sich ihre Leckerlis spielend aus den Bällen rollen.
Dagegen müssen sich die Syrischen Braunbären etwas mehr anstrengen. Um ihr Futter zu erreichen, müssen sie sich aktiv betätigen. Dafür eignen sich beispielsweise Bungee-Seile, an denen Fleischstücke befestigt werden können. Gefüllte Heunetze sorgen neben leckeren Futterspießen bei den Bauernhoftieren wie Ponys, Eseln oder Rindern für Neugier und Abwechslung zur täglichen Fütterung. Die Tiere sind dadurch länger mit Fressen beschäftigt, was dem natürlichen Fressverhalten der Huftiere zugutekommt.
„Geistige und körperliche Herausforderungen halten unsere Zootiere fit und gesund, zu viel Bequemlichkeit schadet ihnen genauso wie uns Menschen“, berichtet Sandra Reichler, Kuratorin im Zoo Heidelberg. Die Mähnenrobben bleiben mit unterschiedlichen Bällen aktiv in Bewegung, die beim täglichen Training eingesetzt werden. Exotische Gerüche, wie Katzenminze, stehen zur Freude der Großkatzen auf der Wunschliste.
Diese Düfte sind bei den feinen Raubtiernasen sehr beliebt. Neben der Tierbeschäftigung unterstützen wichtige Utensilien die Tierpfleger bei der täglichen Arbeit. Wie zum Beispiel digitale Thermometer, um die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu bestimmen, oder Hufmesser für die Fußpflege bei den Dickhäutern. Durch die eingehenden Spenden kann das vorhandene Budget für andere, notwendige Projekte, die noch anstehen, sinnvoll genutzt werden.
„Es ist daher schön, wenn der ein oder andere Wunsch auf diesem Wege erfüllt werden könnte“, so Zoodirektor, Dr. Klaus Wünnemann. Wer sich an dieser Aktion beteiligen möchte, kann über die Wunschliste einen passenden Artikel auswählen und online reservieren: www.zoo-heidelberg.de/wunschliste
Das Zoo-Team freut sich über jeden Wunsch, der in Erfüllung geht.
Das Foto zeigt Lemuren, die die Geschenke erobern.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Am 24. Dezember 2018 brachte Elefantenkuh Lai Sinh den kleinen Elefantenbullen Santosh zur Welt, nun ist das jüngste Mitglied der Hagenbeck´schen Elefantenherde am Mittwoch, 22. November 2023 nach nur zweitägiger Krankheit gestorben.
„Es ist ein trauriger Tag für Hagenbeck. Wir sind zutiefst schockiert und in großer Trauer über dieses plötzliche Ereignis“, zeigt sich Geschäftsführer Dr. Dirk Albrecht bestürzt.
Das für alle Jungelefanten gefährliche Herpes-Virus war mit großer Wahrscheinlichkeit der Auslöser für den plötzlichen Tod. Der hochpathogene Erreger sorgt immer wieder für Todesfälle bei Elefantenjungtieren in vielen Zoos weltweit, dabei sind rund 65 Prozent der Jungtiere bis zum neunten Lebensjahr betroffen.
In den vergangenen 30 Jahren sind in europäischen Zoos mehr als 30 Asiatische Elefanten an Herpes gestorben. Bisher gibt es noch keinen Impfstoff gegen die Krankheit, jedoch befindet sich aktuell ein wirksames Impfmedikament in der Entwicklung. Die genauen Umstände, die zum Tod des Jungbullen geführt haben, werden nun die Ergebnisse der pathologischen Untersuchung zeigen.
Trotz der ständigen Überwachung und der schnellen, bestmöglichen veterinärmedizinischen Versorgung durch die Zootierärzte waren bedauerlicherweise alle Maßnahmen erfolglos.
„Obwohl wir um die weite Verbreitung des gefährlichen Herpes-Virus unter Elefanten wissen und ständig bestrebt sind, einen Ausbruch der Krankheit zu unterbinden, ist beim Ausbrechen des Krankheitsbildes die Überlebenschance gering. Jeder Elefant, ob in der Natur oder in zoologischen Einrichtungen, trägt höchstwahrscheinlich dieses Virus schlummernd in sich“, teilt der Zootierarzt Dr. Flügger mit.
Für die übrigen Elefanten der Hagenbeck-Herde, die bereits über das Risikoalter hinaus sind, besteht keine weitere Gefahr an dem Virus zu erkranken.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Der aufwändige Transport, der bereits in den frühen Morgenstunden in München startete, verlief ruhig und ohne Komplikationen. Panang lebt künftig auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) für Asiatische Elefanten gemeinsam mit ihrer Mutter und Schwester im Zoo Zürich.
Wie bereits seit Wochen geplant, wurde am Dienstagmorgen zunächst das übliche Training im Hellabrunner Elefantenhaus absolviert. Einziger Unterschied: Draußen auf der Außenanlage stand vor einem der Tore ein großer, beheizter Spezialcontainer, in den Panang im Anschluss an das routinierte Training hineingeführt wurde.
„Sowohl das Training als auch das Hineinführen in den Container verlief sehr entspannt. Panang ging ganz ruhig und unaufgeregt rückwärts in den Container, sodass wir diesen anschließend zügig verladen konnten“, erzählt Daniel Materna, Teamleiter der Hellabrunner Elefantenpfleger. Der etwa fünf Tonnen schwere Spezialcontainer wurde mit Hilfe eines mobilen Autokrans von der Anlage auf einen Anhänger und schließlich auf einen Tieflader verladen.
Dann ging es mit einem auf Zootiertransporte spezialisierten Unternehmen auf die Autobahn in Richtung Zürich. Der Transport wurde von den beiden Hellabrunner Elefantentierpflegern Daniel Materna und Robert Ostermeier begleitet, die auch die ersten Tage nach dem Umzug in Zürich bleiben.
Die Ankunft am frühen Abend in Zürich verlief ebenfalls unaufgeregt. „Panang hat den Container ohne Zurückhaltung verlassen. Sie konnte sich dann erst einmal etwas akklimatisieren, bevor sie die erste Nacht in ihrer neuen Heimat in einer großen Sandbox mit frischen Ästen, viel Heu und einem kleinen Badebecken verbrachte“, erläutert Daniel Materna. Am ersten Tag wird Panang zunächst die Gelegenheit haben, ihre neue Umgebung ungestört zu erkunden, bevor es dann in den nächsten Tagen zum ersten Zusammentreffen von Panang und ihrer Mutter Ceyla und Schwester Fahra kommen wird.
Der Münchner Tierparkdirektor Rasem Baban zeigt sich zufrieden: „Der gesamte Umzug von der Vorbereitung bis zur Umsetzung verlief sehr professionell und routiniert und war eine herausragende Leistung des gesamten Teams.“
Elefantenkuh Panang wurde am 13. Februar 1989 im Zoo Zürich geboren und zog 1995 in den Tierpark Hellabrunn. Auf Empfehlung des EEPs ist sie dorthin zurückgezogen, um künftig mit ihrer schon recht alten Mutter Ceyla-Himali (geboren 1975) und ihrer ihr bisher nicht bekannten, jüngeren Schwester Fahra (geboren 2005) zusammenzuleben. Ziel dahinter ist es, dass Elefanten in zoologischen Gärten wie auch ihre Artgenossen in der Natur in matriarchalen Strukturen zusammenleben, also im Familienverbund mit verwandten Elefantenkühen.
„Es freut mich sehr, dass der Umzug nach Zürich erfolgreich umgesetzt wurde. Ich wünsche Elefantenkuh Panang alles Gute für das weitere Ankommen im Zoo Zürich und das Wiedersehen mit ihrer Mutter und Schwester,“ sagt Verena Dietl, Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks Hellabrunn.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Viele Besucher freuen sich auf den Weihnachtsmarkt der besonderen Art, da er an einem ganz speziellen Ort stattfindet und auch die Mitarbeiter des Zoos fiebern dem Start inzwischen entgegen. Der Tierpark Nordhorn lädt in diesem Jahr wieder rund um seine wachsenden historischen Gebäude zu seinem besinnlichen Familienweihnachtsmarkt ein. Die ganz besondere Stimmung mit viel Kunsthandwerk inmitten eines Lichtermeers lässt Kinderaugen leuchten und die Herzen der Erwachsenen höherschlagen.
Von Freitag, 1. Dezember 2023 bis Sonntag, 10. Dezember 2023, ist der stimmungsvolle Markt mitten im Zoo geöffnet. Und für alle, die nicht genug davon kriegen, gibt es am 3. Adventswochenende (16. Dezember 2023 und 17. Dezember 2023) eine Verlängerung.
„Die Adventszeit ist die Zeit der Hoffnung, der Vorfreude und des Lichts!“ so Zoodirektor Dr. Nils Kramer. „Wir haben uns auch angesichts der angespannten Krisensituationen in der Welt bewusst dazu entschieden, den Weihnachtsmarkt durchzuführen und insbesondere den Kindern Freude und Licht zu schenken!“
Der Eintrittspreis zum Weihnachtsmarkt konnte trotz der allgemeinen Preissteigerungen stabil bleiben. Das Ticket kostet 6 Euro (Abendkasse 7 Euro) und gilt ab 15:00 Uhr für alle Personen ab 4 Jahre. Jahreskarteninhaber und Fördervereinsmitglieder zahlen keinen Extraeintritt. Menschen mit einer Behinderung und im Besitz eines Ausweises können für 2 Euro in den Tierpark kommen. Wer den Familienhund auch mit auf den Weihnachtsmarkt im Zoo nehmen möchte, zahlt ebenfalls 1 Euro an der Kasse.
Der Familienweihnachtsmarkt im Tierpark hat sich inzwischen weit über die Grenzen der Grafschaft Bentheim herumgesprochen – er gilt als Inbegriff eines besinnlichen Marktes mit ganz besonderer Stimmung rund um die historischen Gebäude und einem gelungenen Gesamtkonzept mit viel Kunsthandwerk! „Wir wollen mit unserem Konzept alle Familien und hier insbesondere die kleinen Kinder in feierliche Weihnachtsstimmung versetzen,“ so Weihnachtsmarkt-Organisatorin Heike Stevens.
Wie im vergangenen Jahr gibt es zur Eröffnung des Marktes ein stimmungsvolles Lichterfest am Freitag, 1. Dezember 2023. Gegen 16:00 Uhr startet Bauer Hinnerk mit dem beleuchteten Esel Titus, begleitet von den evangelischen Pfadfindern mit dem letztjährigen Friedenslicht, sowie dem ökumenischen Kinderchor Veldhausen/Osterwald in Richtung lebender Krippe. Die Buden auf dem
Weihnachtsmarkt öffnen dann erstmals für die kommenden 10 Tage ihre Türen. An der Bude des Fördervereins Tierpark Nordhorn e.V. kann am Eröffnungsfreitag außerdem ab 16:00 Uhr nach Herzenslust geknobelt werden.
An den Wochenenden wird der Markt ab 14:00 Uhr und in der Woche ab 16:00 Uhr geöffnet sein. Letzter Einlass ist täglich gegen 19:00 Uhr. Der Weihnachtsmarkt ist bis etwa 20:00 Uhr geöffnet. In den festlich beleuchteten Holzhütten auf dem Zooweihnachtsmarkt präsentieren sich verschiedene regionale Anbieter mit kunsthandwerklichen Produkten. Das kulinarische Angebot der Zoogastronomie ist überall verteilt auf dem Markt zu finden. Auch das Heuerhaus und der alte Borggrevesaal sind in das Gesamtkonzept eingebunden. Das Angebot besteht in erster Linie aus regionalen Produkten mit Fleisch von den zooeigenen Tieren.
Und wer seinen Glühwein mal ganz gemütlich im Strandkorb bei weihnachtlicher Musik genießen will, der ist auf dem Weihnachtsmarkt im Familienzoo sowieso genau richtig. Als weiteres Highlight ist auch der Weihnachtmann beziehungsweise der Nikolaus wieder eingeladen und wird an den drei Sonntagen (3. Dezember 2023, 10. Dezember 2023 und 17. Dezember 2023) von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr alle Kinder mit einer kleinen Überraschung im Saal der ehemaligen Gastronomie Borggreve begrüßen und sich ihre Wünsche anhören.
Dort werden an den Samstagen ab 14:00 Uhr auch die Imkerfrauen und die Vorleser der Stadtbibliothek mit dem beliebten Wachskerzendrehen und weihnachtlichen Geschichten zu Gast sein. Erstmals können sich interessierte Kinder auch zum Knusperhausbasteln anmelden. Die Tickets dazu gibt es im Onlineshop des Zoos.
Neu im Programm ist auch eine kostenlose Schatzsuche für Kinder. Die Zettel zur Teilnahme gibt es am Zooeingang. Die Abgabe der ausgefüllten Zettel erfolgt über den Postkasten des Weihnachtsmannes im alten Borggrevesaal. Es werden schöne Preise verlost, die Gewinner schriftlich benachrichtigt.
An den meisten Tagen des Marktes werden auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter der historischen Schmiede den Hammer schwingen und das Bastelteam des Nijnhuuser Schöppkens wird im alten Borggrevesaal schöne weihnachtliche Dinge mit den Kindern herstellen.
Aufgrund des großen Andrangs werden alle Nordhorner gebeten nach Möglichkeit mit Fahrgemeinschaften oder am besten mit dem Fahrrad zum Weihnachtsmarkt zu kommen! Einweiser und zusätzliche Beschilderung weisen dabei den rechten Weg. An allen drei Wochenenden wird es zudem einen Shuttleservice in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr geben. Die Stationen sind der Bahnhof Nordhorn, der Parkplatz am Delfinoh und die Rückseite des Tierpark-Eingangsgebäudes.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Der Verdacht wurde im Rahmen der pathologischen Untersuchung vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bestätigt. Die Erkrankung tritt in ganz Deutschland auf und wurde im Verlauf des Jahres bereits in verschiedenen Regionen Bayerns nachgewiesen.
Zur Vorbeugung wird empfohlen den ungeschützten Kontakt zu lebenden oder toten Wildtieren zu vermeiden. Die zu den Risikogruppen zählenden Personen sollten sich beim Umgang mit erkrankten oder toten Wildtieren strikt an die Hygienevorgaben halten.
Dies gilt insbesondere beim Umgang mit Wildbret. Wildgerichte sollten auch aufgrund anderer Erkrankung nur gut durchgegart verzehrt werden. Auch Katzen und Hunde sollen von Feldhasen und Kadavern ferngehalten werden.
Die Hasenpest (Tularämie) wird von einem Bakterium (Francisella tularensis) verursacht, das überwiegend bei freilebenden Nagetieren und Hasenartigen vorkommt. Infizierte Tiere zeigen die Symptome einer fieberhaften Allgemeininfektion mit Abmagerung, Schwäche und Apathie. Aufgrund von Entkräftung können infizierte Tiere ihre natürliche Scheu verlieren. Die Tularämie ist auf den Menschen übertragbar.
Eine Infektion kann vor allem bei intensivem Kontakt mit erkrankten Tieren oder deren Ausscheidungen beziehungsweise beim Umgang mit Kadavern oder erlegtem Wild stattfinden. Als Risikogruppe sind vor allem Jäger, Köche, Metzger sowie Tierärzte betroffen. Beim Kochen wird der Erreger abgetötet.
Beim Menschen beginnt die Erkrankung nach einer Inkubationszeit von zirka 3 bis 5 Tagen mit unspezifischen, grippeartigen Symptomen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Mattigkeit. An der Eintrittsstelle zeigt sich ein geschwürig zerfallendes Bläschen.
Die regionären Lymphknoten schwellen stark an und vereitern. Gegebenenfalls können innere Organe befallen sein und sich eine Lungenentzündung entwickeln. Trotz des Vorkommens des Erregers in der deutschen Feldhasenpopulation sind nur wenige Erkrankungsfälle beim Menschen bekannt.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr waren die Rettungskräfte über den Brand des freistehenden Hauses an der Ortsstraße des Beilngrieser Ortsteils Aschbuch informiert worden.
Bereits bei der Anfahrt der alarmierten Feuerwehr schlug dichter Rauch aus mehreren Fenstern. Die Bewohner hatten sich selbst ins Freie begeben können.
Die Einsatzkräfte brachten den Brand zügig unter Kontrolle, dennoch entstand hoher Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich.
„Zwei Hunde verendeten durch die Inhalation von giftigem Rauchgas“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt.
Und er fügte hinzu: „Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar.“
Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch am Dienstag die Ermittlungen übernommen. Bei einer Begehung des Brandortes durch Spezialisten der Kripo am wurde festgestellt, dass das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt ausgelöst worden war.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Das Geheimnis ist gelüftet: Der Nachwuchs der Tasmanischen Nacktnasenwombats im Erlebnis-Zoo Hannover ist männlich. Tierarzt Dr. Viktor Molnár bestätigte bei der Erstuntersuchung, was das Team bereits seit längerem vermutet hat. Ein Männchen. Und dazu quirlig und gesund.
„Das Jungtier entwickelt sich bestens“, freut sich Zoo-Tierarzt Molnár. Der kleine Wombat ist mittlerweile sehr flink unterwegs, wenn er seiner Mutter durch das Outback folgt. Und typisch für einen späteren Tunnelbauer, hat er bereits lange, kräftige Krallen.
Einen Namen für den dritten Nachwuchs wird das Zoo-Team in Kürze vergeben. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger hatten in den letzten Wochen verschiedene Vorschläge für Weibchen und Männchen gesammelt. Nach der offiziellen Bestätigung des Geschlechts, kann der Name nun ausgewählt werden.
Europaweit gibt es nur 21 Tiere der Unterart des Tasmanischen Nacktnasenwombats in zoologischen Gärten. Kelly und Maya sind die einzigen Vertreter ihrer Unterart in Deutschland. Für die beiden ist es der dritte gemeinsame Nachwuchs. Weitere Haltungen des Tasmanischen Nacktnasenwombats gibt es im belgischen Pairi Daiza, im niederländischen Brabant, in Budapest, Prag und in Kopenhagen.
Steckbrief
• Tasmanischer Nacktnasenwombat (Vombatus Ursinus Tasmanienses)
• Herkunft: Australien (Tasmanien), Feucht- und Trockenwälder
• Nahrung: Gräser, Kräuter, Pilze, Wurzeln
• Größe: 70 bis 115 Zentimeter lang
• Gewicht: 22 bis 39 Kilogramm
• Erreichbares Alter: bis 26 Jahre in menschlicher Obhut
• Tragzeit: 22 Tage + 6 bis 7 Monate Beuteltragezeit, Geburtsgewicht 2 Gramm
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen