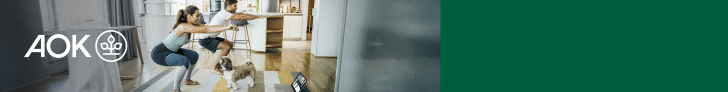- Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
- Weihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
- Drill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
- Koala-Baby lüftet das Geheimnis seines Beutels – Einzigartige Einblicke pünktlich zu Halloween!
- Elefantenrettung mit Hightech-Medizin: Wie Akito seinen Stoßzahn (fast) verlor – und doch behielt!
- Wildtierspuren zwischen Afrika und Augsburg: Erleben Sie faszinierende Einblicke hinter die Kulissen des Artenschutzes!
- Zootag im Augsburger Zoo
- Tolle Zuchterfolge im Neunkircher Zoo
- Hunde sind dauerhaft im Zoo willkommen
- Exklusive Aktion in der ZOOM-Erlebniswelt
- Redaktion
Weihnachten und damit auch die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Eine ideale Zeit, um einen Familienausflug in den Tiergarten Kleve zu starten. „Wir sind auch an den Weihnachtsfeiertagen täglich ab 9:00 Uhr geöffnet“, berichtet Tiergartenleiter Martin Polotzek.
Und er fügte hinzu: „An Heiligabend und Silvester schließen wir ausnahmsweise allerdings bereits um 13:00 Uhr, an den anderen Feiertagen sind wir sie sonst auch regulär von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Und so bietet es sich an, die Zeit bis zum Christkind im Tiergarten zu verbringen oder aber in den Weihnachtsferien einen Familienausflug in unseren Zoo zu unternehmen.“
Neben niedlichen Jungtieren wie dem Lamafohlen Fridolin oder dem Nachwuchs bei Meerschweinchen und Zwergotter können sich die Gäste des Familienzoos am Niederrhein auch auf eine Weihnachtsferienrallye freuen: Passend zu den Weihnachtsferien wartet eine weihnachtliche Tiergartenrallye auf alle großen und kleinen Tiergartengäste.
So kann man nicht nur erfahren, wie man Lama und Alpaka am einfachsten auseinanderhalten kann, sondern auch was der Name „Roter Panda“ ursprünglich bedeutet oder was Meerschweinchen bei Freude machen. Alle, die die Weihnachtsferienrallye richtig lösen, erhalten eine Packung Tierfutter gratis.
Der Tiergarten Kleve ist auch im Winter und an den Weihnachtsfeiertagen täglich von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet (Öffnungszeiten an Heiligabend und Silvester von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr). In den Weihnachtsferien wartet die kostenlose Weihnachtsferienrallye auf alle kleinen Gäste (bitte eigenen Stift mitbringen), bei denen jeder mit dem richtigen Lösungswort eine gratis Packung Tierfutter erhält.
Außerdem können sich die Besucher auf zahlreiche Jungtiere bei den Lamas, Meerschweinchen, Zwergottern, Alpakas und Lisztaffen freuen, sodass der Tiergartenbesuch auch in der Weihnachtszeit zu einem tierischen Highlight wird.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Die bis dato noch nicht geschlechtsidentifizierten Zwillinge sind der erste Nachwuchs der 2022 im Görlitzer Tierpark eingezogenen afrikanischen Buschschliefer.
Nach einer Tragzeit von etwa siebeneinhalb Monaten kam das Ebenbild ihrer Eltern vollständig behaart und weit entwickelt zur Welt.
„Vom ersten Tag an zeigten die Jungtiere eine beeindruckende Agilität und folgten ihrer Mutter mühelos in die oberen Bereiche ihres Geheges,“ äußert sich Tierpark-Kuratorin Catrin Hammer begeistert über den Nachwuchs.
Auf den ersten Blick sehen die bis zu 3 Kilogramm leichten Buschschliefer aus wie kaninchengroße Nagetiere. Ihre nächsten Verwandten sind taxonomisch aber Elefanten und Seekühe.
Im Gegensatz zu diesen können sie jedoch mit Hilfe, der mit dicken Hautpolstern versehenen Sohlen, sehr geschickt klettern. Diese tagaktiven und geselligen Tiere sind in ihrem ostafrikanischen Savannenlebensraum vor allem in Felsen oder auf Bäumen anzutreffen.
Trotz winterlicher Temperaturen können Besucher des Görlitzer Tierparks die jetzt fünfköpfige Buschschliefertruppe in ihrem Gehege beobachten und so einen einzigartigen Einblick in das Familienleben dieser faszinierenden Tiere erhalten.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Am Montagabend gegen 18:00 Uhr wurde auf der Staatstraße zwischen Rennertshofen und Monheim ein Reh angefahren und es lief anschließend weiter.
Der verständigte Jagdpächter machte sich auf die Suche nach dem verletzten Tier.
Auf der Staatstraße zwischen Ehekirchen und der Hollenbacher Kreuzung ereigneten sich gegen 17:10 Uhr gleich zwei Unfälle mit Rehen.
Dort hatten mehrere Rehe die Fahrbahn gekreuzt. Zwei Autos kollidierten mit je einem Reh, die dabei getötet wurden.
Bei den an den Wildunfällen beteiligten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Einen angefahrenen noch lebenden Biber bemerkte ein Autofahrer am späten Montagabend gegen 22:00 Uhr auf der Fahrt von Lichtenheim in Richtung Karlshuld.
„Der Verkehrsteilnehmer handelt vorbildlich, sicherte die Gefahrstelle ab und zog das auf der Fahrbahn liegende Tier von der Straße“, so ein Sprecher der Neuburger Polizei.
Und er fügte hinzu: „Der angefahrene Biber verendete vor Ort.“
Die Polizei weist darauf hin, dass nach Wild-/Tierunfälle auf der Straße liegengebliebene verletzte und tote Tiere in jedem Fall abgesichert werden müssen, um Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern.
Die verständigte Polizei oder der Revierinhaber haben die Möglichkeit, verletzte Tiere schnellstmöglich von ihrem Leid zu erlösen.
„Im vorliegenden Fall kam es glücklicherweise zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer“, so der Polizeisprecher abschließend.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Sie ist quietschfidel, neugierig und liebt es, im Wasser zu toben. Die Rede ist von der jungen Eisbärin Anouk aus dem Eismeer, die am heutigen Dienstag, 19. Dezember 2023, ihren ersten Geburtstag im Tierpark feiert.
Bereits am Montag hat das Hagenbeck-Team zusammen mit rund 20 Erstklässlern, der Eisbärenklasse der Schule Forsmannstraße, dem Tierpfleger-Team und verschiedenen Medienvertretern die zirka 110 Kilogramm schwere Jungeisbärin gebührend gefeiert.
Nach einer kurzen Begrüßung durch den Zootierarzt Dr. Flügger wurden Mutter Victoria und Jungtier Anouk auf die Außenanlage gelassen, auf der die Tierpfleger des Eismeeres bereits eine Eistorte aus Fleisch und Fisch, einen Weihnachtsbaum und ein Spielzeug aus Wasserschläuchen platziert haben.
Beide Eisbären stürzten sich gleichermaßen auf die schmackhafte Geburtstagsüberraschung und wurden anschließend mit einem weiteren Geschenk, das die Tierpfleger in das Gehege fallen ließen, überrascht. Ein großer, ballähnlicher Bootsfender lockte Anouk direkt von den Resten der Eistorte ins Wasser.
Als gebührenden Abschluss des Geburtstagsprogramms gaben die Erstklässler der „Eisbärenklasse“ der Schule Forsmannstraße ein Geburtstagsständchen für Anouk vor der Kulisse des Eismeeres. Farbenfrohe Weihnachtsdekorationen, die die Schüler für den Geburtstag von Anouk gebastelt haben, wurden anschließend an einen Weihnachtsbaum gehängt.
Auch Für Anouk war die Feier ein kleines Spektakel. Im Wasser zeigte das Geburtstagskind wieder mal seine wasserakrobatischen Fähigkeiten. Mittlerweile frisst Anouk täglich zwischen drei und fünf Kilo Fleisch, Fisch, Reisbrei und Obst. Zusätzlich wird sie nach wie vor von Mama Victoria gesäugt.
Und Anouks prominenter Taufpate „Sasha“? Auch er hat sich zum Geburtstag seines Patentieres gemeldet und herzliche Grußworte geschickt. Er ist überwältigt, wie schnell sein Patenkind gewachsen ist.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1:40 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizei von mehreren Verkehrsteilnehmern verständigt, dass sich in direkter Nähe der B 300-Anschlussstelle „Hohenwart“ auf der Bundesstraße ein Pferd befinden soll.
Die kurz darauf eingetroffenen Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Pfaffenhofen sicherte dann die Stelle schnell ab und fing das Tier ein.
Anschließend übergaben die Beamten das Pferd dem Besitzer. Zu einer Verkehrsgefahr kam es nicht, das Pferd nahm auch keinen Schaden.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Aufmerksame Verkehrsteilnehmer beobachteten am Sonntag einen freilaufenden Hund im Bereich des Denkendorfer Gewerbegebietes in der Nähe der Autobahnauffahrt.
Die verständigte Polizei schickte eine Streifenbesatzung aus und den Polizisten gelang es mit Hilfe der Mitteiler den Hund einfangen und zur Beilngrieser Polizeiinspektion zu verbringen.
„Da der tierische Ausreißer bereits von seinem Herrchen vermisst wurde, setzte sich dieser mit der Polizei in Verbindung“, so ein Polizeisprecher.
Und er fügte abschließend hinzu: „Beide konnten letztendlich wieder zusammengeführt werden.“
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Rémy ist eine Madagaskar-Riesenratte. Zu sehen bekommt den meist nachtaktiven Riesennager kaum jemand. Auch die Tierpfleger brauchen in der Regel technische Unterstützung, um einen Blick auf die madagassischen Nagetiere zu erhaschen. Nun gelang ein seltenes Foto bei Tageslicht.
Sie haben große Ohren, schwarze Kulleraugen und ein bräunliches Fell: Auch sonst ähnelt die Madagaskar-Riesenratte in ihrem Aussehen eher einem Kaninchen, als einer Ratte. Als Untermieter der Schwarz-Weißen Varis, einer Lemurenart von Madagaskar, führen die Nagetiere ein zurückgezogenes Leben. „Wenn wir zum Dienst kommen, haben sie sich meist schon in die unterirdischen Höhlen zurückgezogen, wo sie den Tag verbringen. Erst zur Dämmerung werden sie wieder aktiv und wuseln umher“, weiß Revierleiter Philipp Goralski um die Gewohnheiten der sympathischen Nagetiere.
Der Tierpfleger und seine Kollegen bekommen die scheuen Tiere daher nur selten zu Gesicht. Um sie zu beobachten, greift das Zoo-Team daher auf technische Mittel zurück. „Nachtsichtkameras an den Futterplätzen ermöglichen uns, am Leben unserer Schützlinge teilzuhaben“, so Goralski.
Mit Rémy, der im tschechischen Zoo Plzen geboren worden ist, beteiligt sich der Zoo Duisburg aktiv an der Erhaltungszucht der stark gefährdeten Nagetiere, die europaweit in nur elf Zoos gehalten werden. „Ziel ist es, eine gesundere Reservepopulation unter geschützten Bedingungen aufzubauen“, erklärt Biologe Oliver Mojecki.
Das dies unbedingt notwendig ist, zeigt der Blick in den ursprünglichen Lebensraum der Votsotsas, wie die Madagaskar-Riesenratte auch genannt wird. Die Trockenwälder im Westen der Insel sind weitestgehend zerstört. Schätzungen gehen davon aus, dass die im besten Fall verbliebenden 5.000 Tiere auf Madagaskar nur noch auf einer Fläche von rund 470 Quadratkilometern leben – ein nicht zusammenhängendes Areal, welches von menschlichen Siedlungen zerschnitten ist und immer kleiner wird.
Neben der anhaltenden Zerstörung ihres Lebensraumes, durch illegale Rodung für den Mais- und Erdnussanbau, werden die großen Nager vom Menschen und verwilderten Haushunden gejagt. Daher gilt die Madagaskar-Riesenratte als „stark gefährdet“ und wird auf der sogenannten Roten Liste geführt.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Manchmal jedoch sieht der Alltag ganz anders aus. Das merken auch unsere vierbeinigen Begleiter und neigen zu Nervosität und Unruhe. Lesen Sie hier, wie Sie Ihrem Hund die Weihnachtstage leicht machen, sodass die ganze Familie diese besondere Zeit genießen kann.
Bitte ersparen Sie Ihrem Hund den Stress beim Shopping und nehmen Sie ihn nicht auf die Einkaufstour mit. Eine Sache in der Adventszeit können Sie aber mit Ihrem Vierbeiner teilen: das Plätzchenbacken.
Doch Vorsicht: Das heißt nicht, dass Sie Ihren Hund von den gezuckerten Plätzchen naschen lassen sollten. Stattdessen gibt es Rezepte für spezielle Hundekekse, die Sie zusammen mit ihm backen können.
Bieten Sie ihm diese Kekse zu besonderen Stunden und als Belohnung an. No-Gos zu Weihnachten sind:
• Süßigkeiten oder andere Leckereien, die von uns zu Weihnachten gerne gegessen werden.
• Schokolade: Kakao ist für Hunde echtes Gift. Schon geringe Mengen enthalten den Wirkstoff Theobromin, der für Hunde tödlich sein kann.
• Apropos Gift: Der in der Weihnachtszeit beliebte Christstern ist eine für Hunde giftige Pflanze. Passen Sie auf, dass vor allem Welpen nicht daran knabbern. Bestenfalls verzichten Sie auf die Pflanze.
{loadposition 4}
• Der Festtagsbraten eignet sich nicht für Hunde, da er zu stark gewürzt, scharf oder gesalzen ist.
• Lassen Sie Essensreste und Süßigkeiten nicht unbeaufsichtigt herumliegen.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Nichts von alldem schützt sie davor, dass ihr Bestand in der Natur sinkt – weswegen die Weltnaturschutzunion IUCN sie als gefährdete Art einstuft. Der Tiergarten der Stadt Nürnberg setzt sich daher für ein koordiniertes Zuchtprogramm ein und freut sich über ein gesundes Harpyien-Jungtier.
Das Küken ist Mitte Oktober 2023 geschlüpft. „In den ersten Tagen haben wir mit der Pinzette zugefüttert, weil die Mutter noch etwas unbeholfen war und die Fleischstückchen nicht ausreichend zerkleinert hatte“, erzählt Tierpflegerin Jessica Liebel.
In der Natur ernähren sich Harpyien von größeren Säugetieren wie zum Beispiel verschiedenen Affenarten, Faultieren, Opossums, Baumstachler oder Ameisenbären. Im Tiergarten gibt es für sie Kaninchen, Meerschweinchen und andere Nagetiere sowie das Fleisch von Huftieren. Nach wenigen Tagen kümmerte sich Mutter Evita selbst um das Jungtier, das mittlerweile kräftig zugelegt hat und drei Kilogramm wiegt.
Es ist der erste Harpyien-Nachwuchs in Nürnberg seit 20 Jahren und der erste des Altvogelpaares Evita und Jorge, die seit 2020 zusammen sind. Seitdem hatte Evita 13 Eier gelegt, von denen sechs befruchtet waren. Fünf der Küken sind vor dem Schlupf gestorben.
Die Zucht von Harpyien ist sehr anspruchsvoll. Ein Grund dafür ist die Luft: Anders als in den Regenwäldern Süd- und Mittelamerikas, wo Harpyien natürlicherweise leben, ist sie bei uns vergleichsweise trocken.
„Das kann dazu führen, dass die Flüssigkeit im Ei zu schnell verdunstet“, sagt Tierpflegerin und Revierleiterin Susann Müller. „Deswegen kann eine Naturbrut heikel sein, da das Ei zu schnell an Gewicht und Feuchtigkeit verliert. Der Brüter ist oft der sicherere Weg.“
Im Brüter liegen die Eier bei 37 Grad Celsius und werden mehrmals täglich automatisch sowie zusätzlich von den Tierpflegerinnen und -pflegern gewendet. Die Luftfeuchtigkeit kann dort je nach Bedarf angepasst werden. Das nun geschlüpfte Küken haben ausschließlich die Altvögel ausgebrütet. Doch auch hier haben die Tiergartenmitarbeitenden nachgeholfen: Mit Wachs haben sie ein kleines Loch in der Eierschale geschlossen und so verhindert, dass Keime eindringen und Feuchtigkeit entweicht.
Anders als viele andere Vogelarten haben Harpyien keine saisonalen Paarungs- und Fortpflanzungszeiten. Bis ein Küken schlüpft, dauert es durchschnittlich 52 bis 58 Tage. Harpyien können bis zu 40 Jahre alt werden, mit zirka sechs erreichen sie die Geschlechtsreife und ziehen von
da an in der Natur etwa alle drei Jahre ein Jungtier groß.
Diese vergleichsweise langen Fortpflanzungszyklen verleihen der Einstufung der Harpyien als gefährdete Art zusätzliche Brisanz: Denn ihr Lebensraum wird schneller zerstört, als sie sich anpassen und fortpflanzen können. Die Urwaldriesen, auf denen die Vögel in mehreren Dutzend Metern Höhe nisten, sind bei illegal agierenden Holzhändlern beliebt.
Regenwälder werden gerodet und durch industriell bewirtschaftete Monokulturen fragmentiert. Menschliche Infrastruktur, die mit dem oft illegalen Abbau von Rohstoffen und der Landwirtschaft einhergeht, frisst sich immer tiefer in die Verbreitungsgebiete der Harpyien.
Sobald eine Art, die sich so langsam fortpflanzt wie die Harpyie, als vom Aussterben bedroht gilt, wird es schwieriger, ihr Ende zu verhindern. Deshalb setzt sich der Tiergarten Nürnberg für eine koordinierte Zucht der Tiere ein. „Wir sehen schon jetzt, dass die Population dieser Tiere in der
Natur abnimmt“, sagt Dr. Lorenzo von Fersen, Kurator für Artenschutz und Forschung im Tiergarten Nürnberg. „Ein großes Ziel ist es daher, ein koordiniertes Zuchtprogramm aufzubauen, an dem sich nicht nur europäische Zoos, sondern auch solche aus Nord, Mittel- und Südamerika
beteiligen“.
Seit vielen Jahren engagiert sich der Tiergarten Nürnberg zudem auch aktiv in Erhaltungsmaßnahmen vor Ort, indem er vor allem brasilianische Wissenschaftler bei der Durchführung genetischer Studien an der Art unterstützt. Eine weitere wichtige Aufgabe des Zoos ist es, alle Maßnahmen vorzubereiten, die notwendig sind, wenn stark bedrohte Arten in Not sind.
Dr. Lorenzo von Fersen erklärt: „Die künstliche Befruchtung ist eines der Instrumente, an denen wir arbeiten. Zusammen mit Dr. Dominik Fischer, dem Kurator für Forschung und Artenschutz im
Grünen Zoo Wuppertal, wurden erste Schritte in diese Richtung unternommen und die Ergebnisse sind sehr vielversprechend.“
Der Tiergarten Nürnberg hält seit 1980 Harpyien. Das damalige Paar kam durch eine Beschlagnahmung aus einer Privathaltung in die Obhut des Zoos. Heute leben im Tiergarten und auf seiner Außenstelle „Gut Mittelbüg“ insgesamt sechs Harpyien. In vier europäischen Zoos gibt es derzeit nur zehn Harpyien. Von den Nürnberger Tieren ist nur eines für Besucherinnen und Besucher sichtbar: Domingo, der im Bereich der Greifvögel oberhalb der Bartgeiervoliere zu finden ist. Auch der Jungvogel wird nicht für Besucherinnen und Besucher zu sehen sein.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich war es am 13. Dezember 1973 – damals noch unter dem Namen „Lemurenhaus“. Seitdem ist es ein Ort, der immer wieder nachhaltig neu genutzt wird für spannende Tierbeobachtungen, moderne Umweltedukation und zukunftsweisende Forschungs- und Artenschutzarbeit.
Passend zum Jubiläum sind jetzt Mongozmakis in das Haus eingezogen. Das fünfjährige Weibchen „Emena“ und der 26-jährige Mann „Newton“ kamen Anfang November aus dem Tierpark Berlin nach Köln.
Mongozmakis (eulemur mongoz) sind eine Primatenart aus der Familie der Lemuren. Sie kommen in trockenen Laubwäldern im Norden Madagaskars und auf den Komoren vor. Sie sind tag- und nachtaktiv und leben in der Regel in kleinen Familienverbänden. Ihre Nahrung besteht aus Früchten, Blüten, Nektar und Blättern. Die Kopf-Schwanz-Länge beträgt bis zu 83 Zentimeter, das Gewicht variiert zwischen 1,1 und 1,6 Kilogramm.
Zoo-Besucher aufgepasst: Männchen und Weibchen unterscheiden sich deutlich – so auch „Newton“ und „Emena“. Männchen „Newton“ hat ein grau-braunes Rückenfell, eine dunkle Schwanzspitze, einen rötlich-braunen Nacken und Bart sowie eine graue Schnauze. Weibchen „Emena“ weist ein helleres Rückenfell, ein cremefarbenes Bauchfell und einen weißen Bart zur Unterscheidung auf. Die Tiere können in Menschenobhut bis zu 35 Jahre alt werden.
Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft Mongozmakis in der madagassischen Wildnis als „vom Aussterben bedroht“ ein. Gründe sind Lebensraumzerstörung, zum Beispiel für Landwirtschaft oder Holzkohleproduktion, sowie Bejagung durch die bitterarme Bevölkerung des vor Ostafrika gelegenen Inselstaats. Leider ist die Tierwelt Madagaskars insgesamt stark gefährdet. Dies ist umso tragischer, da sehr viele Tiere der Insel endemisch sind, das heißt, nur auf Madagaskar vorkommen.
Der Kölner Zoo engagiert sich im Verbund mit anderen Zoos und Forschungseinrichtungen im Rahmen der „Madagascar Flora and Fauna Group“ seit Jahren massiv für den Erhalt dieser einzigartigen Habitate.
Der Zoo schiebt zahlreiche Schutzmaßnahmen an – zum einen im Zoo selbst, zum anderen vor Ort in Madagaskar. In Köln zählen dazu beispielsweise Erhaltungszuchtprogramme bei hochseltenen madagassischen Fischen und Vögeln, die für Reservepopulationen für spätere Rückführungen aufgebaut werden, sowie Fundraising- und Umweltbildungsprojekte.
Zudem laufen wissenschaftliche Studien, zum Beispiel zum Ernährungs- oder Fortpflanzungsverhalten. Damit lässt sich besser verstehen, was bedrohte Arten für ihren Schutz in der Wildnis benötigen.
VVor Ort, auf Madagaskar, ist der Kölner Zoo ebenfalls aktiv. Die verantwortliche Zoo-Kuratorin, Dr. Johanna Rode-White, bereiste die Insel, um Schutzvorhaben bewerten und einschätzen zu können.
Auf dieser Basis fördert der Kölner Zoo zwei konkrete Projekte:
•Er finanziert eine Forschungsstation im Süden Madagaskars als Teil von Wiederaufforstungsarbeiten. Zudem finanziert der Kölner Zoo lokale Ranger, die die verbliebenen und die aufgeforsteten Gebiete schützen. Partner dabei ist die Organisation „Tropical Biodiversity Social Enterprise“.
•• Der Kölner Zoo unterstützt Im Nationalpark Anakarafantsika, wo sowohl Coquerel-Sifakas als auch Mongozmakis leben, eine Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Dabei untersuchen zwei madagassische Doktoranden die Fähigkeit verschiedener Lemurenarten, verbrannten und sich erholenden Wald wieder zu besiedeln.
Möglich wird all dies nicht zuletzt durch den Artenschutz-Euro, die der Zoo auf jede Erwachsenen-Tageskarte erhebt. Zoobesucher sind damit Artenschätzer!
50 Jahre! Vom Lemuren- zum Madagaskarhaus – eine kleine Zeitreise:
• 1967: Planung des Hauses zunächst als Interimsbau für das in die Jahre gekommene Affenhaus anstelle der alten Fasanerie.
• 13. Dezember 1973: Eröffnung des jetzt den Lemuren gewidmeten „Lemurenhauses“. Zusätzlich zu 95 Lemuren ziehen noch zwölf Languren und 16 Saki-Affen in das Haus.
• 2009: Die Tierpfleger-Gänge hinter den Anlagen werden den Tieranlagen zugeschlagen, deren Fläche sich dadurch deutlich vergrößert.
• 1981: Zwei Schwarz-Weiße Varis zieren das neue Logo des Zoos. Sie stehen symbolisch für die großen Erfolge in der Lemurenhaltung und -nachzucht.
• 2003: Bartaffen ziehen ein und die Gitterkugel wird installiert.
• ab 2008: Die letzten Kleideraffen ziehen in das Urwaldhaus für Menschenaffen um. In die Anlage am Kopfende des Hauses ziehen Bartaffen ein. Mit dem Bau des Hippodoms wird die Außenanlage der kopfständigen Anlage gekappt. Die Bartaffen ziehen in das Urwaldhaus um, neu hinzukommen verschiedene madagassische Vögle, Reptilien und Kleinsäuger. Das Haus heißt fortan „Madagaskarhaus“.
• 2019: Auf Initiative der Pfleger und mit Unterstützung der Werkstatt wird aus der Madagaskaranlage ein begehbares Nachttierhaus mit versetztem Tag-Nacht-Rhythmus
• 2022: Dank des Artenschutz-Euros kann das Engagement des Zoos in Madagaskar um zwei weitere Projekte erweitert werden.
• 2023: 50. Jubiläum – Mongozmakis leben im Haus.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Am 14. Dezember 2023 wird Bärenstummelaffe „Melanie“ 30 Jahre alt. Ihre Kinder und Enkelkinder leben in vielen europäischen Zoos. In der Wildbahn ist die Tierart akut vom Aussterben bedroht.
Der weltweit älteste Bärenstummelaffe in einem Zoologischen Garten lebt in Duisburg. Am 14. Dezember 1993 ist Melanie geboren worden. Für ihre Tierpflegerinnen und Tierpfleger ist der Bärenstummelaffe ein absolutes Charaktertier.
Wenn Alexander Nolte über seinen Schützling spricht, kommt der Revierleiter des Duisburger Affenhauses ins Schwärmen. „Melanie ist einmalig, ein Charaktertier unseres Zoos. Wenn wir sie beobachten, so erinnert sie uns manchmal an eine etwas tatterige, alte Oma – man kann unsere Seniorin einfach nur mögen und ins Herz schließen“.
Viele der Mitarbeitenden, so auch Alexander Nolte, kennen Melanie bereits seit ihrer Ankunft im Jahre 2005. Damals reiste der Bärenstummelaffe vom Zoo Erfurt ins Ruhrgebiet. Am Kaiserberg zog die Affendame vier Jungtiere erfolgreich auf, die mittlerweile in unterschiedlichen europäischen Zoos leben und auch dort bereits für Nachwuchs gesorgt haben.
„Deswegen ist Melanie bereits mehrfach Oma und auch schon Uroma geworden“, weiß Tierpfleger Nolte.
Im Laufe der Jahre ist die „Grande Dame“ älter geworden, bewegt sich meist sehr langsam und das mit Bedacht. Ihre Liebe für gekochte Kartoffeln hat sie über die Jahre beibehalten. „Wenn es die Knollen gibt, kommt sie direkt zu uns Pflegern, riecht ausgiebig an ihrem Lieblingsfutter, was sie dann laut schmatzend verspeist“, so der Pfleger.
Generell ist der Speiseplan der Seniorin auf ihre Bedürfnisse angepasst. Neben Blättern, der Hauptnahrung der Bärenstummelaffen, bieten die Mitarbeitenden Futter an, was sich leicht kauen lässt. Ihre Umgebung beobachtet Melanie, trotz zunehmend schlechter Augen, noch immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
„Das hat manchmal etwas von einer Rentnerin. Man könnte meinen, es fehlt nur noch das Kissen unter den Ellenbogen“, schmunzelt Nolte über den etwas anderen Mensch-Tier-Vergleich. Den Lebensabend die Seniorin in trauter Zweisamkeit mit Partner Pagalu, der mit seinen 21 Jahren das drittälteste Tier im weltweiten Zoobestand ist.
Seit 1967 hält der Zoo Duisburg die seltenen Bärenstummelaffen. Über 50 Jungtiere wurden in den vergangenen Jahrzenten am Kaiserberg geboren. Aufgrund dieser Erfolge wird das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für die bedrohte Primatenart von Duisburg aus koordiniert. „Die Aufgabe des EEP liegt darin, passende Zuchtgruppen zusammen zu stellen und eine zukunftsfähige Population in Menschenhand aufzubauen“, erklärt Zootierärztin Dr. Carolin Bunert, die das EEP leitet.
Eine Notwendigkeit, denn in den tropischen Regenwäldern Westafrikas sind die Tiere akut vom Aussterben bedroht. „Bärenstummelaffen kommen nur in einem kleinen Verbreitungsgebiet in Westafrika vor. Verschwindet dieser ohnehin kleine Lebensraum weiter, steht das Überleben einer ganzen Tierart auf dem Spiel“, verdeutlicht Dr. Bunert.
Zum Schutz der Tiere in Afrika engagiert sich der Zoo Duisburg daher im Rahmen des Projektes WAPCA (West African Primate Conservation Action). Das Projekt setzt sich insbesondere für den Erhalt von bedrohten Affenarten ein, welche unter anderem in den Regenwäldern der Elfenbeinküste Leben. Ein Fokus der Projektverantwortlichen ist dabei insbesondere der Erhalt des sensiblen Ökosystems Regenwald.
Ihren Namen tragen Bärenstummelaffen wegen des zurückgebildeten Daumens, einer Anpassung an die Fortbewegungsweise in Bäumen. Denn beim Schwingen zwischen den Ästen nutzen die Tiere ihre Finger wie einen Haken – ein Daumen wäre hier hinderlich.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Wälder verschwinden, und mit ihnen ihre Bewohner. Doch es gibt Lichtblicke, so zum Beispiel in Kambodscha. Hier betreibt der Allwetterzoo Münster ein Artenschutzzentrum. Vor Kurzem wurden dort bedrohte Vögel ausgewildert.
„Wir freuen uns über die guten Nachrichten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Kambodscha“, sagt Dr. Philipp Wagner. Er ist Kurator für Artenschutz & Forschung im Allwetterzoo Münster.
Und er fügte hinzu: „Das Angkor Centre for Conservation of Biodiversity (ACCB) ist eine Artenschutzeinrichtung des Allwetterzoos. Im November 2023 hat das Team dort vier bedrohte Vögel ausgewildert. Unterstützt wurde das ACCB von zwei lokalen Einrichtungen.“
Drei der vier ausgewilderten Tiere waren indochinesische Ährenträger Pfaue. Es handelt sich um eine weltweit bedrohte Art. Die Pfauen schlüpften im Frühling im ACCB. Ein halbes Jahr später waren sie bereit, ausgewildert zu werden. „Die Ansiedelung dieser Vögel ist ein bedeutender Schritt diese Art zu erhalten“, betont Wagner.
Das Verbreitungsgebiet des Ährenträgerpfaus erstreckte sich über große Teile Asiens. Heute ist der Ährenträger Pfau in wenigen Gebieten zu finden. Der Abstand zwischen diesen Gebieten verhindert die Fortpflanzung der Tiere.
Der vierte Vogel war ein Asiatischer Wollhalsstorch. Das Tier wurde im September 2023 von ACCB und Partnern gerettet. Es wurde verletzt und flugunfähig gefunden. Nach tierärztlicher Betreuung und Genesung wurde der Asiatische Wollhalsstorch freigelassen. Er ist gesund davongeflogen, heißt es seitens der Mitarbeiter im ACCB. Asiatische Wollhalsstörche sind ebenfalls bedroht. Sie werden gejagt und der Lebensraum wird immer kleiner.
„Wir sind stolz, Teil dieser Erfolgsgeschichten im Arten- und Naturschutz zu sein. Wir danken unseren Partnern und Unterstützern, die dies möglich gemacht haben“, so Wagner. „Gemeinsam schützen wir Tierwelt und Lebensräume für kommende Generationen.“
Damit die Tiere nicht umsonst nachgezogen und ausgewildert werden, gibt es zahlreiche Maßnahmen. Die lokale Regierung sowie Nicht-Regierungs-Organisationen (NROs) arbeiten erfolgreich mit dem ACCB zusammen. Sie kämpfen gemeinsam für den Erhalt der Lebensräume und gegen Wilderei.
Das Foto zeigt einen Asiatischen Wollhalsstorch, der vom Team des ACCB ausgewildert wird.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
In der Heidelberger Gorillagruppe wird es einen Wechsel geben. Weibchen N’Gambe zieht diese Woche in den Zoo Frankfurt um. Für sie wird Anfang nächsten Jahres ein neues Weibchen nach Heidelberg kommen.
Gorillagruppen sind dynamisch, es kommt immer wieder zu Wechseln in der Zusammensetzung der Individuen, sowohl in der Natur als auch in Zoos. Die Männchen und die Weibchen verlassen ihre Geburtsgruppe mit Erreichen der Geschlechtsreife. Ausgewachsene männliche Tiere, Silberrücken genannt, führen einen Harem von mehreren Weibchen an, die in der Regel nicht miteinander verwandt sind.
Die Übernahme durch einen neuen Haremsführer oder Unverträglichkeiten zwischen den Weibchen führen dazu, dass einzelne Tiere auch im erwachsenen Alter die Gruppe wechseln oder ganze Haremsgruppen zerbrechen und sich neu wieder zusammensetzen. Dies ist im Zoo Heidelberg der Fall: Die beiden Gorillaweibchen N’Gambe und Sheila hatten kein besonders enges Verhältnis zueinander.
Nach dem Tod des dritten Weibchens ZsaZsa verstärkten sich die Spannungen zwischen ihnen. Silberrücken Bobo ist zwar sehr erfahren, zeigt sich jedoch mit den Streitigkeiten zwischen seinen beiden Weibchen zunehmend überfordert. Die sehr dominante und intelligente N’Gambe hat es immer wieder verstanden, den Gorillamann gegen das rangtiefere Weibchen Shaila aufzustacheln - keine schöne Situation für das Tier.
Nach Rücksprache mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für Gorillas wurde beschlossen, N’Gambe in eine andere Gruppe zu integrieren und stattdessen ein anderes Weibchen für die Heidelberger Gruppe auszusuchen.
„Die Gorillagruppe in Frankfurt ist deutlich größer. Dort leben Weibchen verschiedenen Alters, in deren Gruppe N‘Gambe aufgenommen werden soll. Hier wird das intelligente und dominante Weibchen viele neue Herausforderungen vorfinden, die ihr sicher gut tun werden. Gleichzeitig können wir den Druck auf unser zweites Weibchen verringern.“, erklärt Sandra Reichler, Kuratorin im Zoo Heidelberg.
Die Pfleger vom Zoo Frankfurt waren bereits in Heidelberg, um N’Gambe kennenzulernen und sich mit den Kollegen auszutauschen. Sie sind sehr optimistisch, dass sich N‘Gambe in Frankfurt gut in die Gruppe integrieren wird. Welches Weibchen als Nachfolgerin für sie nach Heidelberg ziehen wird, steht derzeit noch nicht endgültig fest.
Der Zoo Heidelberg steht in engem Kontakt mit dem Gorilla EEP, das genaue Empfehlungen zu Gruppenzusammensetzungen für Gorillas in den einzelnen Zoos innerhalb Europas gibt.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen