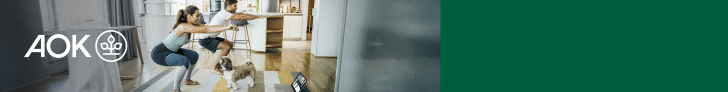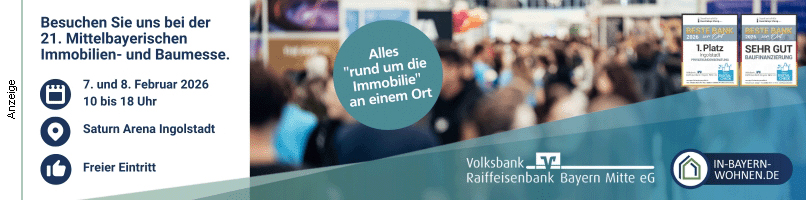- Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
- Weihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
- Drill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
- Koala-Baby lüftet das Geheimnis seines Beutels – Einzigartige Einblicke pünktlich zu Halloween!
- Elefantenrettung mit Hightech-Medizin: Wie Akito seinen Stoßzahn (fast) verlor – und doch behielt!
- Wildtierspuren zwischen Afrika und Augsburg: Erleben Sie faszinierende Einblicke hinter die Kulissen des Artenschutzes!
- Zootag im Augsburger Zoo
- Tolle Zuchterfolge im Neunkircher Zoo
- Hunde sind dauerhaft im Zoo willkommen
- Exklusive Aktion in der ZOOM-Erlebniswelt
- Redaktion
Beim Spaziergang durch die weitläufige Parkanlage können Besucher verschiedene Tiere beobachten und an schattigen Plätzen verweilen. Die Zoo-Akademie bietet Führungen, Ferienworkshops und Geburtstagsangebote an, was einen interessanten Ausflug für diejenigen darstellt, die Natur kennenlernen möchten oder eine Pause vom Alltag suchen.
Eintauchen in die Welt Südamerikas
In der großen begehbaren Voliere am Elefantenhaus gibt es zahlreiche interessante Beobachtungsmöglichkeiten. Es empfiehlt sich, etwas mehr Zeit einzuplanen, um die gesamte Anlage zu erkunden. Grünwangenamazonen sind auf den Ästen zu sehen, während die Sonnenralle ihre Flügel in die warmen Sonnenstrahlen ausbreitet. Im Teich schwimmen Ruderenten – erkennbar an ihrem leuchtend blauen Schnabel – auf der Suche nach Nahrung. Mit etwas Glück können auch die Faultiere beobachtet werden. Wenn sie sich entlang der Äste hangeln, um frisches Laub von den Büschen zu fressen, zeigt sich ihre erstaunliche Beweglichkeit. Ein Insider-Tipp: Bei Außentemperaturen von 20 Grad fühlen sich Faultiere besonders wohl, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, sie in Aktion zu sehen.
Ein Blick in die Kinderstube
Einige Zootiere sind derzeit mitten in der Aufzucht ihrer Jungen. Besucher haben die Möglichkeit zu beobachten, wie die Jungtiere in den kommenden Wochen und Monaten aufwachsen. Bei den Orangebrust-Trupialen sind die ersten Küken geschlüpft und werden von den Eltern mit Insekten versorgt. Das kleine Känguru hat den mütterlichen Beutel verlassen und bewegt sich nun über die Australien-Wiese. Vom neuen Podest innerhalb der Känguruanlage können Zoobesucher den Nachwuchs gut beobachten.
Erst vor ein paar Tagen wurde ein junger Blessbock geboren. Wie für Blessböcke üblich, kann das Jungtier schon wenige Stunden nach der Geburt laufen und zeigt sich als Teil der Herde. Im großen Affenhaus gibt es besonders flauschigen Nachwuchs: Anfang Kronenmaki zur Welt. Die ersten Wochen trug die Mutter das Jungtier ständig bei sich. Inzwischen ist es so fit, dass es beginnt, allein das Gehege zu erkunden.
Noch mehr Zoo-Erlebnisse mit der Zoo-Akademie
Die Zoo-Akademie bietet im Sommer spannende Programme wie Rundgänge, Kindergeburtstage, Abendführungen und Workshops für alle Altersgruppen. In den Pfingstferien gibt es noch freie Plätze im Techniklabor. Schulkinder können hier an einer Roboter-Safari teilnehmen, 3D-Drucker ausprobieren oder elektronische Fledermäuse programmieren. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Für die Abendführung am 18. Juni 2025 sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Individuelle Rundgänge an einem Wunschtermin sind ebenfalls buchbar. Echte Anschauungsmaterialien wie Felle, Schädel und Federn machen die Tour besonders interessant.
Das Foto zeigt die Zoo-Akademie, die in den Pfingstferien spannende Angebote bietet.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Wer rund um Ostern durch den Zoo Heidelberg spaziert, erlebt den Frühling mit allen Sinnen: mehr als 20.000 Frühblüher verwandeln die Parkanlage in ein buntes Blumenmeer, die Störche klappern wieder und in immer mehr Gehegen gibt es Nachwuchs zu entdecken. Extra für die Ostertage hat das Tierpflegeteam das bei kleinen und großen Zoobesuchern beliebte Ostergehege im Durchgang zwischen Bauernhof und Explo-Halle hergerichtet. Flauschige Küken tummeln sich zwischen jungen Kaninchen- und Meerschweinchen. Übrigens: An den Osterfeiertagen hat der Zoo Heidelberg regulär von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet.
Vorsichtig picken sich winzige Schnäbel aus den Eierschalen und läuten die Osterzeit ein: Die aufgeweckten Hühnerküken wuseln nun gemeinsam mit dem Nachwuchs der Meerschweinchen und Kaninchen durch Stroh und Streu im eigens für die Feiertage hergerichteten Ostergehege. Mit viel Liebe hat das Tierpflegeteam auch in diesem Jahr im Durchgang zwischen Bauernhof und Explo-Halle für ein tierisches Highlight gesorgt, das nicht nur den kleinen Zoobesuchern ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Die munteren Jungtiere gehören zu ganz besonderen Rassen: Goldbrakel-Hühner und Lux-Kaninchen sind selten gewordene Haustierrassen, für deren Erhalt sich der Zoo Heidelberg einsetzt.
Auch außerhalb des Ostergeheges blüht das Leben auf: Die Parkanlage des Zoo Heidelberg hat sich in den vergangenen Wochen in ein buntes Meer aus mehr als 20.000 Blüten verwandelt, die von zahlreichen Schmetterlingen, Bienen und Hummeln umschwärmt werden. Zwischen den Osterglocken, Hyazinthen und Tulpen streifen Helmperlhühner und die pechschwarzen Cemani-Hühner herum, während nebenan das Trampeltierfohlen fröhlich in der Frühlingssonne herumtobt und die neun kleinen Husumer-Ferkel den Bauernhof unsicher machen.
Auf einem Spaziergang durch den Zoo werden Besucher vom lauten Geklapper der Störche begleitet. Viele Storchenpaare haben ihre Nester auf dem Zoogelände bezogen und sind mitten in der neuen Brutsaison. Auf der Suche nach geeignetem Nistmaterial fliegen sie immer wieder über die Köpfe der Besucher hinweg – ein Naturerlebnis mitten in der Stadt.
Der Zoo Heidelberg hat an allen Osterfeiertagen regulär von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet. Wer also zwischen Schokohasen und Eiersuche Lust auf echte Tiere, frische Luft und farbenfrohe Frühlingsmomente hat, ist im Zoo Heidelberg herzlich willkommen.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Was machen die Zoo-Tiere am Abend? Wie fühlt es sich an, ohne andere Besucher durch den Zoo zu schlendern? Welche Tiere lassen sich in den Abendstunden besser beobachten? Antworten und viele weitere Tiergeschichten liefern die Zoo-Ranger bei einer stimmungsvollen Abendrunde durch den Zoo Heidelberg.
Ab Freitag, 11. April 2025 bis einschließlich September 2025 finden jeweils am zweiten Freitag des Monats Abendführungen statt. Im April 2025 und Mai 2025 gibt es aufgrund der hohen Nachfrage zusätzliche Samstagstermine. Die Führungen dauern jeweils von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr und richten sich an Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.
Die Durchsage, dass der Zoo Heidelberg in wenigen Minuten schließt, ist gerade erst verklungen. Während die letzten Tagesbesucher den Heimweg antreten, versammelt sich neben dem Haupteingang eine kleine erwartungsvolle Gruppe. Für sie beginnt das Zooerlebnis jetzt erst – in einer ganz besonderen Abendstimmung. Auf dem Zoogelände selbst kehrt Ruhe ein. Idyllisch legt sich die Dämmerung über den alten Baumbestand und die Tiere in den Gehegen gehen in den „Feierabendmodus“ über. Die kleine Gruppe streift gemeinsam mit einem Ranger durch den abendlichen Zoo.
Die Teilnehmer haben die exklusive Möglichkeit, den Zoo Heidelberg ohne die betriebsame Geräuschkulisse des Tages zu erleben. Stattdessen rücken die Geräusche der Tiere in den Vordergrund. Was raschelt dort im Bambus bei den Tigern? Hört sich das Brüllen des Löwen lauter an als tagsüber? Abgerundet wird die Tour mit spannenden Geschichten aus der Tierwelt des Zoos und anschaulichen Materialien zum Anfassen, welche der Ranger für die Gäste im Gepäck hat.
Vereine, Familien oder andere Gruppen können dieses atmosphärische Highlight zudem exklusiv an einem individuellen Termin buchen. Anfragen bitte per Mail an
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Über zehn Jahre lang war der Asiatische Elefant Khin Yadanar Min fester Bestandteil der Elefanten-WG im Zoo Heidelberg. Nun ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Der 15-jährige Elefant ist alt genug, um als Zuchtbulle in einen anderen Zoo zu ziehen. Auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms für Asiatische Elefanten zieht Elefant Yadanar in einen Zoo in den Niederlanden.
Elefant Khin Yadanar Min kam im Alter von fünf Jahren im Herbst 2014 in den Zoo Heidelberg. War er zu Beginn ein eher zurückhaltender Elefant, ist er inzwischen zu einem souveränen Bullen mit Teamplayer-Mentalität herangewachsen. Mit seiner umgänglichen Art trug er viel zu einem guten Zusammenleben bei.
Die intensive Arbeit mit dem Elefanten hat sich gelohnt, erinnert sich Revierleiter Stefan Geretschläger: „Yadanar hatte mit ungefähr acht Jahren, also mitten in der Pubertät, eine Phase, in der es ihm schwerfiel, sich zu konzentrieren und er seiner Umwelt jede Gefühlslage deutlich gezeigt hat. Mit viel Geduld und Trainingseinheiten konnten wir ihn dabei unterstützen, zu einem selbstsicheren Bullen zu reifen.“
Wer Elefant Yadanar vor seiner Abreise noch einmal besuchen möchte, hat in den nächsten Wochen noch Gelegenheit dazu. Besonders wenn die Tage wieder wärmer werden, sind die Elefanten oft beim gemeinsamen Spielen und Rangeln auf der Außenanlage zu beobachten. Einen besonderen Einblick in die Arbeit mit den Dickhäutern gibt es beim Training mit den Elefanten, welches die Besucher immer an Wochenenden und Feiertagen um 14 Uhr an der Trainingswand erleben können.
„Elefant Yadanar hat eine sehr gute Entwicklung in seinem Sozialverhalten gezeigt – so wie es bei uns in Heidelberg in der Jungbullen-WG vorgesehen ist. Seine Ausbildung hier ist nun abgeschlossen und wir können ihn guten Gewissens weiterziehen lassen“, erklärt Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann. Die Zeit in Heidelberg ist für jeden Elefanten begrenzt. Als erster Zoo in Deutschland hatte es sich der Zoo Heidelberg 2009 zur Aufgabe gemacht, eine Anlauf- und Ausbildungsstelle für junge Elefantenbullen zu werden und so das Erhaltungszuchtprogramm für Asiatische Elefanten mit einer besonderen Rolle zu unterstützen.
Grundlage der Elefantenhaltung in Heidelberg ist das natürliche Verhalten der jungen Elefantenbullen: Mit rund fünf Jahren verlassen sie ihre Geburtsgruppe und schließen sich zu Junggesellengruppen zusammen. Diese Möglichkeit des Zusammenlebens erhalten sie im Zoo Heidelberg.
Gemeinsam mit den anderen jungen männlichen Elefanten testen sie ihre Kräfte und lernen wichtige Verhaltensweisen, welche sie als erwachsene Elefanten benötigen. Sobald die Jungbullen mit 12 bis 15 Jahren sozial gereift sind, können sie den Zoo Heidelberg verlassen. Sie sind nun in der Lage, in anderen Zoos die Rolle eines Zuchtbullen zu übernehmen und werden von den Elefantenkühen als Partner akzeptiert.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Rote Pandas gehören zu den Besucherlieblingen im Zoo Heidelberg – umso größer ist die Freude, dass es wieder ein Pärchen gibt: Ein zweijähriges Rotes-Panda-Weibchen aus Frankreich ist im Zoo Heidelberg angekommen. Es kam auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) und könnte gemeinsam mit dem Heidelberger Männchen in Zukunft für Nachwuchs sorgen. Die stark bedrohte Art leidet unter der Zerstörung ihres Lebensraums, weshalb jede erfolgreiche Zucht wichtig ist. Zuletzt wurden im Zoo Heidelberg im Juli 2022 zwei Jungtiere geboren.
Neuzugang aus Frankreich – Eine Chance für den Arterhalt
Seit Ende Februar 2025 ist es da: Ein Rotes-Panda-Weibchen aus einem französischen Zoo in der Auvergne hat ihr neues Zuhause im Zoo Heidelberg bezogen – und hat sich direkt gut eingelebt. Damit gibt es wieder ein Pärchen in den Baumwipfeln der Anlage, in der auch die Schopfhirsche leben. „Wir freuen uns, dass das junge Weibchen gleich so neugierig und zugänglich ist. Auch unser Männchen ist sehr interessiert an ihr. Die Chemie scheint direkt zu stimmen. Wieder ein Panda-Paar in Heidelberg zu haben, ist eine wichtige Chance für den Erhalt dieser bedrohten Tierart“, erklärt Sandra Reichler, Kuratorin im Zoo Heidelberg. „Wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren mit etwas Glück Nachwuchs gibt.“
Im Zoo Heidelberg gab es zuletzt im Juli 2022 Panda-Nachwuchs: Zwei weibliche Jungtiere wurden erfolgreich aufgezogen und im Rahmen des EEP an andere Zoos abgegeben, um dort zur Arterhaltung beizutragen.
Bedrohter Lebensraum – Warum Rote Pandas Schutz brauchen
Rote Pandas, auch Katzenbären genannt, leben in Höhen zwischen 1.500 und 4.200 Metern in den Bergwäldern des Himalajas. Doch ihr Lebensraum wird immer kleiner. In vielen Regionen hat sich die Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten mehr als verdoppelt. Um Platz für Felder und Siedlungen zu schaffen, werden die Wälder abgeholzt. Auch Wilderei und die Konkurrenz mit Weidetieren setzen den Tieren zu. Mit weniger als 10.000 Individuen in der Natur stuft die Weltnaturschutzunion (IUCN) den Roten Panda als gefährdet ein. Der Zoo Heidelberg engagiert sich im Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP), das eine gesunde Zoopopulation aufbaut und der bedrohten Tierart eine Zukunft sichert.
Die Tageslänge gibt den Takt vor
Die Paarungszeit der Roten Pandas fällt in der Regel in die Wintermonate zwischen Dezember und März. Wenn sich das neue Weibchen weiter so gut eingewöhnt, könnte es also im kommenden Jahr spannend werden.
Interessant: In Zoos südlich des Äquators findet die Paarung ein halbes Jahr zeitversetzt statt. Vermutlich spielt die Tageslänge eine entscheidende Rolle. Die anschließende Tragzeit von durchschnittlich 130 Tagen fällt in den Frühling, wenn das Nahrungsangebot am größten ist – gute Voraussetzungen für das trächtige Weibchen. So kommen die Jungtiere in den Sommermonaten zur Welt, wenn die Umweltbedingungen für ihre Aufzucht ideal sind. „Die Natur hat hier eine ausgeklügelte Strategie entwickelt“, erklärt Reichler. „Indem die Fortpflanzung an die Tageslänge gekoppelt ist, wird sichergestellt, dass die Jungtiere zu einer Zeit geboren werden, in der genug Nahrung zur Verfügung steht.“
Die besten Beobachtungszeiten für Besucher
Mit ihrem dichten rostroten Fell, der weißen Gesichtszeichnung und dem buschigen Schwanz gehören die Roten Pandas zu den Publikumslieblingen im Zoo Heidelberg. Besonders, wenn sie geschickt durch die Äste klettern oder mit ihrer tapsigen Art über die Baumstämme balancieren, ziehen sie die Blicke der Besucherinnen und Besucher auf sich. Wer sie in Aktion erleben möchte, sollte früh morgens oder am späten Nachmittag vorbeischauen. Denn Rote Pandas schlafen bis zu 17 Stunden und sind überwiegend in der Dämmerung aktiv.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Der Neuzugang aus Frankfurt bereichert die Artenvielfalt im Zoo
Heidelberg.
Flink, wachsam und entfernt mit Elefanten verwandt:
Das Rotschulter-Rüsselhündchen hat nicht nur das Potenzial zum Besucherliebling
im Zoo Heidelberg, sondern bietet auch spannende Einblicke in die Welt der
hochspezialisierten Bodenbewohner der immergrünen Wälder Ostafrikas. Zu
beobachten ist es im kleinen Affenhaus bei den Schildturakos.
Was huscht da am Boden bei den Schildturakos im kleinen Affenhaus? Es ist das neue Rotschulter-Rüsselhündchen! Dieses kleine Säugetier gehört zur Familie der Rüsselspringer und ist mit seiner rüsselartigen Schnauze und den langen Hinterbeinen perfekt an das Leben am Waldboden angepasst. Mit seinen circa 500 Gramm und inklusive Schwanz bis zu 50 Zentimetern Länge wirkt es auf den ersten Blick wie eine riesige Spitzmaus, doch tatsächlich gehört es zur Tierordnung der Rüsselspringer.
Diese sind mit Tenreks und Goldmullen verwandt, aber auch die Gruppe der Elefanten, Erdferkel und Seekühe ist systematisch nicht weit entfernt. „Das Rüsselhündchen ist eine spannende Tierart, die in deutschen Zoos relativ selten gezeigt wird“, so Kuratorin Sandra Reichler. „Es bietet faszinierende Einblicke in die Anpassungen an seinen Lebensraum.“
Ihre bewegliche Schnauze hilft ihnen, den Waldboden nach Insekten und anderen Wirbellosen zu durchwühlen, die sie mit ihrer langen Zunge aufnehmen. Die tagaktiven Einzelgänger sind immer auf der Hut vor zahlreichen Fressfeinden wie Schlangen oder Greifvögeln. Sie halten sogar ihre Wege im Unterholz frei von Zweigen, um bei Gefahr schnell fliehen zu können.
Zwar gilt das Rotschulter-Rüsselhündchen aktuell in der Roten Liste der IUCN nicht als gefährdet, aber ihre Bestände nehmen kontinuierlich ab. Leider ist zu erwarten, dass auch diese Art bald einen Bedrohungsstatus erhält. In Ostafrika werden die immergrünen Wälder, die seinen Lebensraum bilden, durch Abholzung zerstört. „Das Rüsselhündchen steht stellvertretend für zahlreiche Tiere, die von der Zerstörung der Wälder betroffen sind“, betont Reichler. „Mit seiner Haltung im Zoo wollen wir auf diese Probleme aufmerksam machen und die Bedeutung des Waldschutzes verdeutlichen.“
Im kleinen Affenhaus teilt sich das Rüsselhündchen als Bodenbewohner das Gehege mit den Schildturakos, einer afrikanischen Vogelart mit metallisch schimmerndem Federkleid. Die Kombination aus flinken Bewegungen am Boden und dem regen Treiben in den Ästen macht diesen Bereich zu einem interessanten Schauplatz. Wer es erleben will, hat in den Vormittags- und Mittagsstunden gute Chancen, wenn das Rüsselhündchen besonders aktiv ist – ein faszinierender Einblick in das Leben eines einzigartigen Tieres.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Auf der Roten Liste der IUCN wird die Asiatische Goldkatze als potentiell gefährdet geführt, Tendenz sinkend. Grund dafür sind die zunehmende Bejagung der Kleinkatze und die Zerstörung der Wälder Südostasiens. „Die wertvolle junge Katze aus Indonesien ist vielleicht eine der letzten Chancen für die Erhaltungszucht der Art in europäischen Zoos. Dank der guten Kontakte des Tierpark Berlin Jahr zwei Nachzuchten nach Europa importiert werden.
Der Kater erweitert den Bestand im Tierpark Berlin und wird dort gerade mit einem wertvollen Zuchtweibchen aus der europäischen Population vergesellschaftet „Wir in Heidelberg versuchen die importierte Katze mit einem jungen Kater, der 2022 im Zoo Wuppertal geboren wurde, zusammenzuführen. Die beiden importierten Tiere sind mit den Goldkatzen in Europa nicht verwandt und daher genetisch besonders wertvoll“, so Sandra Reichler, Kuratorin für Säugetiere im Zoo Heidelberg.
Vergangene Woche ist das Weibchen gut aus Berlin in Heidelberg angekommen. Noch ist es vom drei Jahre alten Kater getrennt. „Um der jungen Katze die Eingewöhnung leichter zu machen, haben wir am Außengehege eine Holzverkleidung angebracht und mehr Versteckmöglichkeiten für die scheuen Tiere geschaffen“, erklärt Sandra Reichler. Jetzt heißt es Daumen drücken. „Der Prozess der Vergesellschaftung ist bei Goldkatzen eine Herausforderung und kann mitunter viele Monate dauern. Für eine erfolgreiche Zusammenführung ist viel Erfahrung, vor allem auch der betreuenden Tierpfleger, gefragt“, weiß die Kuratorin.
Die ist auf jeden Fall vorhanden: Seit 1978 züchtet der Zoo Heidelberg Asiatische Goldkatzen und gehört mit 26 überlebenden Jungtieren zu den erfolgreichsten Züchtern dieser Art. Auch das Zuchtbuch des europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) wird hier in Heidelberg von Kuratorin Sandra Reichler geführt. Dennoch liegt der letzte Zuchterfolg fast 20 Jahre zurück. Sandra Reichler kennt den Grund: „Die Goldkatzen-Population in europäischen Zoos ist stark zurückgegangen. Es mangelt an Tieren, die für die Zucht geeignet sind. Das junge Weibchen aus Indonesien ist eine wertvolle Bereicherung für die genetische Vielfalt hier in Europa. Wir hoffen, dass sie sich mit unserem jungen Kater gut versteht.“
Die ersten Tage verlaufen bislang positiv. An einem speziellen Gitter, das zwischen den getrennten Gehegebereichen angebracht ist, können sich die Tiere gefahrlos beschnuppern, sehen und hören. „Die beiden Goldkatzen halten sich regelmäßig am Zwischengitter auf, vor allem der Kater scheint sehr interessiert an der neuen Katze. Sie ist noch etwas zurückhaltend, geht aber auch regelmäßig zum Zwischengitter.“
Neben den Bemühungen des Arterhalts außerhalb des natürlichen Lebensraums (ex situ), engagiert sich der Zoo Heidelberg im Sinne des ganzheitlichen Plans zum Schutz der Artenvielfalt auch vor Ort (in situ). Sandra Reichler hat in den vergangenen Jahren Kontakte zur Clouded Leopard Working Group, einer Artenschutzorganisation in Südostasien, aufgebaut, die der Zoo Heidelberg in diesem Jahr erstmals auch finanziell unterstützt. Mit einem Teil aus den Einnahmen des Artenschutz-Euro werden unter anderem Anti-Wilderer-Einheiten gebildet, die Fallen im Lebensraum der Goldkatze einsammeln. Um Konflikte zwischen Bauern und Goldkatzen zu reduzieren, bauen die Artenschützer darüber hinaus raubtiersichere Hühner- und Ziegenställe.
Das Foto zeigt den dreijährigen Goldkatzen-Kater aus Wuppertal, der in den Zoo Heidelberg zog.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Welche Aufgaben hat ein Tierpfleger im Zoo Heidelberg? Wie wird das Futter für die unterschiedlichen Tierarten zubereitet? Wie lassen sich spannende Beschäftigungs-möglichkeiten für die Zootiere basteln?
Das Programm „Ein Tag bei den Tieren“ bietet tiefe Einblicke in den Zoo-Alltag und die Chance auf hautnahe Tierbegegnungen. Es richtet sich an alle Zoo-Freunde – entweder zum Selbst-Erleben oder zum Verschenken. Termine bis Juni 2025 sind ab sofort verfügbar und ab sofort auch bequem online buchbar.
Das ganze Jahr über gibt es bei „Ein Tag bei den Tieren“ in jedem der fünf Reviere im Zoo Heidelberg einiges zu entdecken. Sandra Reichler, Kuratorin für Säugetiere, kümmert sich seit vielen Jahren um die Betreuung der Teilnehmer des Angebots. „Erfahrungsgemäß sind Termine im Elefanten-, Raubtier- und Affenrevier immer sehr beliebt“, weiß Reichler.
Und sie fügte hinzu: „Ein echter Geheimtipp ist, wie ich finde, aber das Bauernhofrevier. Dort gibt es durchaus ein paar Highlights! In diesem Revier leben neben den typischen Bauernhoftieren auch die Kängurus, Präriehunde und der Kasuar, ein bei Gefahr wehrhafter und von seinem Erscheinungsbild sehr imposanter Vogel“.
Die Teilnehmer von „Ein Tag bei den Tieren“ dürfen im Bauernhofrevier vielen Tieren ganz nahekommen. Beim gemeinsamen Tiertraining mit den Rindern, Eseln, Ponys oder Ziegen stehen sie direkt mit den Vierbeinern auf einer Anlage. So können sie genau beobachten, wie Tierpfleger und Tier in Interaktion treten. Weitere besondere Momente gibt es bei der Pflege der Ponys: Dort helfen die Teilnehmer aktiv mit und striegeln die Tiere. Bei den Kängurus werfen die Teilnehmer einen Blick in den Stall und helfen bei der Futtervorbereitung. Gerne gehen die Tierpfleger aber auch ganz individuell auf die Teilnehmerwünsche ein.
„Ein Tag bei den Tieren“ eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk. Wir haben regelmäßig Teilnehmer, die den Tag von ihrer Familie oder von ihren Freunden geschenkt bekommen haben und denen der Tag sehr viel Freude bereitet hat. Wer Spaß daran hat, mit Tieren zu arbeiten oder schon immer mal Einblick in die Arbeit eines Zoos erhalten wollte, für den ist das genau das Richtige“, berichtet Reichler. Wer nun Lust bekommen hat, einen Tag bei den Tieren im Zoo Heidelberg zu erleben, findet alle Infos zur Anmeldung inklusive Ticketbuchung online. Das Angebot dauert vier Stunden und ist in allen Revieren des Zoo Heidelberg möglich. Es findet bei jedem Wetter statt, das Mindestalter beträgt 16 Jahre.
Das Foto zeigt ein Känguru im Zoo Heidelberg, das von den Teilnehmern zu Beispiel das Futter in Heunetzen vorbereitet bekommt, damit es sich das Tier anschließend schmecken lassen kann.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
„Der Kleine ist topfit und entwickelt sich prima“, sagte Zoo-Tierärztin Dr. Barbara Bach. Auch die Frage nach dem Geschlecht und seinem Namen wird nun beantwortet.
Ganz geheuer ist dem kleinen Löwen die Untersuchung nicht. Revierleiterin Bianca Weißbarth und Tierärztin Dr. Barbara Bach beeilen sich, damit das Jungtier schnell wieder zu seiner Mutter kann. Mit geschultem Auge checkte Dr. Bach den Welpen einmal komplett durch: Gebiss, Augen, Nabel – alles in Ordnung.
Ein Blick auf die Waage: rund sieben Kilogramm. Die Frage nach dem Geschlecht ist eindeutig geklärt: Der kleine Löwe ist ein Kater. Das Tierpflegeteam wird ihn „Nouri“ rufen, das ist arabisch und bedeutet „der Leuchtende“. „‚Nouri‘ entwickelt sich sehr gut. Löwenmama ‚Binta‘ macht das klasse“, stellt die Zoo-Tierärztin zufrieden fest.
Nouri hat nicht nur die Herzen der Zoobesucher im Sturm erobert, sondern auch seine Umwelt. „Der kleine Löwe ist ein echter Schnellstarter. Nach vier Tagen hatte er die Augen offen, tapste schon kurze Zeit später sicher durchs Gehege und war bereits früh auf der Außenanlage unterwegs. Inzwischen probiert er sich sogar schon am Fleisch“, erklärt die Revierleiterin. Dann noch die Impfung und der reiskorngroße Chip, mit dem der Berberlöwe zukünftig eindeutig identifiziert werden kann. Nach nicht einmal fünf Minuten ist der Check-up vorbei.
Löwenmutter Binta putzt ihr Jungtier gründlich sauber und auf den kurzen Schreck gibt es erstmal eine Milch. Wenig später sind die beiden wieder draußen bei Vater Chalid. „Die kleine Löwenfamilie ist in den letzten Wochen zu einem richtigen Rudel zusammengewachsen“, freut sich Bianca Weißbarth.
Schon von Beginn an ließ das Team den Raubkatzen die Wahl, wie und wann sie als Familie zusammenkommen. Eine eher ungewöhnliche Entscheidung. „Normalerweise bleibt der Kater einige Zeit vom Nachwuchs getrennt. Aber wir haben mit der Strategie, den Tieren die Wahlmöglichkeit zu geben, bereits bei unseren Tigern sehr gute Erfahrungen gemacht“, erklärt die Revierleiterin. Und auch hier lagen die Tierpfleger richtig.
Binta sucht mittlerweile die Nähe zu Chalid, Nouri turnt auf dem Rücken seines Vaters herum, und der lässt alles geduldig mit sich machen, selbst wenn der Nachwuchs fest an der Mähne zerrt. Schöne Momente, die die Zoobesucher aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Anlage beobachten können.
Mindestens zwei Jahre wird Nouri im Zoo Heidelberg bleiben. Ob der gebürtige Heidelberger danach dort bleibt, oder in einen anderen wissenschaftlich geführten Zoo wechselt, wird gemeinsam mit dem Projektteam des europäischen Erhaltungszuchtprogramms entschieden. Denn der Junglöwe leistet einen Beitrag zum Artenschutz für die äußerst seltenen Berberlöwen, die seit etwa 100 Jahren in ihrer Heimat Nordafrika ausgerottet sind.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Wer frisst was? Das Thema Tierfutter nimmt im Zoo Heidelberg einen besonderen Stellenwert ein, denn die Zootiere sollen qualitativ hochwertiges und auf die Tierart abgestimmtes Futter erhalten. Dazu ist Heidelsbergs Zoo-Inspektor Jörg Kubacki täglich mit Lieferanten, Partnern und Spendern in Kontakt. Über eine der letzten Spenden – rund eine Tonne frische Wassermelonen von einem Landwirt aus der Region – durften sich unter anderem die Syrischen Braunbären, Stachelschweine und Elefanten Anfang Oktober besonders freuen.
Neugierig wird die grüne Kugel von den Syrischen Braunbären im Zoo Heidelberg beäugt. Was man damit wohl machen kann? Gar nicht so einfach, die runde Frucht mit Schnauze und Tatzen zu fassen zu bekommen. Nach etwas Ausprobieren ist klar: Im Innern verbirgt sich leckeres, rotes Fruchtfleisch! Die Bären sind jedoch nicht die einzigen Zoobewohner, die sich Anfang Oktober über die schmackhaften Früchte freuen konnten. Dank der großzügigen Futterspende sorgten die Wassermelonen auch bei den Stachelschweinen, den Elefanten oder den Stinktieren für Abwechslung in den Gehegen.
Die Melonenspende ist eine von vielen Futterspenden, die der Zoo Heidelberg regelmäßig von mehreren Betrieben aus der Region erhält. Frisch geerntet, aber für den Handel unverkäuflich, landeten die Melonen schließlich als Tierfutter im Zoo Heidelberg.
Inspektor Jörg Kubacki sagte dazu: „Viele Produkte stammen aus einem Überangebot, haben optische Mängel oder nicht die richtige Größe für den Verkauf, sind aber qualitativ gut und verzehrfähig. Wir freuen uns, wenn die Landwirte oder Betriebe aus der Region in diesen Fällen an uns denken. Über jedes Kilogramm Karotten, Äpfel oder Fisch, das wir von den Partnerbetrieben gespendet bekommen, sind wir sehr dankbar!“ Der Zoo Heidelberg steht mit den Spendern in engem Austausch, um sicherzustellen, dass die Zootiere qualitativ einwandfreie Futterspenden erhalten.
Ganz ohne den Einkauf von Futter geht es allerdings nicht – schließlich werden pro Monat beispielsweise rund 400 Kilogramm Äpfel, eine Tonne Karotten und eine Tonne Fisch verfüttert. Welche Futtermittel benötigt werden, um die verschiedenen Futterpläne für die über 150 Tierarten im Zoo Heidelberg abzudecken, weiß Tierärztin Dr. Barbara Bach. Frisches Gemüse und Obst mit wichtigen Vitaminen, Eier, Fleisch und Insekten als Proteinquelle und bei Bedarf zusätzliche Mineralstoffe sind unter anderem wichtig, um den Tierbestand gesund zu halten.
„Nicht nur die ausreichende Menge und Zusammensetzung, auch die Qualität unseres Tierfutters muss stimmen. Bei den Spendern und Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, können wir uns dessen sicher sein“, erklärt Dr. Bach.
Der Zoo Heidelberg hofft, dass die Spendenbereitschaft der Partnerbetriebe in Zukunft so hoch bleibt und sich die Zootiere immer wieder über diese Leckerbissen freuen dürfen. Schließlich bedeutet jeder durch Spenden eingesparte Euro, die Möglichkeit die Entwicklung des Zoo Heidelberg weiter voranzubringen.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Mitte August 2024 sind im Zoo Heidelberg zwei Balistar-Küken geschlüpft. Ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz, denn Balistare zählen zu den seltensten Vögeln der Welt. Entwaldung und illegaler Tierhandel haben die Vogelart im Nordwesten Balis an den Rand der Ausrottung getrieben. Nur dank gezielter Wiederansiedlungsprojekte mit Nachzuchten aus menschlicher Obhut kann der Balistar in seiner ursprünglichen Heimat langsam wieder Fuß fassen.
Sie sind schneeweiß mit stellenweise schwarzer Zeichnung, haben eine auffällige Federhaube und ein besonderes Gesangstalent. Leider werden genau diese Merkmale dem Balistar in seinem ursprünglichen Lebensraum zum Verhängnis. Als Zier- und Käfigvogel hat der Balistar beinahe Kultstatus und steht bei illegalen Tierhändlern hoch im Kurs – obwohl der Fang oder Verkauf seit den 1970er Jahren unter Strafe steht. An der Nordwestküste Balis zählten Forscher 2004 nur noch 20 Exemplare. Die IUCN führt die Vogelart als „vom Aussterben bedroht“.
In den Zoos des Europäischen Verbands für Zoos und Aquarien (EAZA) genießt der hochbedrohte Vogel höchste Priorität. Der Zoo Heidelberg trägt mit der erfolgreichen Nachzucht erneut zum Erhalt der Art in menschlicher Obhut bei. „Wir engagieren uns seit mehr als 40 Jahren für den Artenschutz des Balistars ex situ, also der Zucht und Bewahrung der Tiere außerhalb ihres ursprünglichen Lebensraumes. Unser aktuelles Balistar-Paar haben wir diese Saison zum ersten Mal zusammengesetzt und freuen uns über den überraschend schnellen Bruterfolg. Für eine gesunde genetische Vielfalt ist der Nachwuchs im Zoo Heidelberg von großer Bedeutung“, erklärt Leonhard Aistleitner, Revierleiter im Vogelrevier des Zoo Heidelberg. Besucher des Zoos können die Jungvögel mit ihren Eltern in der Südostasienvoliere nahe des Elefantenhauses beobachten.
Aktuell leben schätzungsweise rund 100 Tiere auf Bali und der benachbarten Insel Nusa Penida. Dass der balinesische Nationalvogel in seinem Lebensraum langsam wieder Fuß fassen kann, ist nur durch gezielte Auswilderungsprojekte mit Nachzuchten aus menschlicher Obhut möglich. „Der Balistar ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine Art, die in der Natur quasi ausgestorben war, durch das Engagement von Erhaltungszuchtprogrammen eine zweite Chance bekommt“, sagt Leonhard Aistleitner.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Es wird wieder wuselig bei den Zwergottern im Zoo Heidelberg. Ende Juli 2024 kamen fünf Jungtiere zur Welt. Damit wächst die Ottergruppe auf sieben Tiere an. Noch kuscheln sich die Kleinen oft ins weiche Stroh der Wurfkiste, doch die Neugier führt den munteren Nachwuchs schon zu ersten Erkundungstouren durch das Gehege. Besucher im Zoo Heidelberg können das gesellige Familienleben oft schon jetzt durch die Scheibe mit Blick auf das Innengehege beobachten.
Wie ein großer flauschiger Fellknäuel kuschelt sich die Otterfamilie in die sorgsam mit Stroh ausgepolsterte Wurfkiste. Die Tiere genießen die Wärme und den Körperkontakt ihrer Artgenossen. Mit ihrem ausgeprägten Familiensinn begeistern Zwergotter viele Tierfreunde. Die Elterntiere leben monogam und kümmern sich gemeinsam um ihre Jungtiere. Sie bringen ihnen bei, wie man Nahrung findet und schützen sie vor Gefahren. Dieses kooperative Verhalten stärkt die familiäre Bindung.
„Unsere beiden Elterntiere sind sehr erfahren und ausgeglichen. Vor allem das Vatertier ist engagiert: Er trägt die Kleinen wieder zurück in die Wurfkiste, wenn sie zu weit weg tapsen, oder ruft sie, wenn es Futter gibt“, erzählt Leonhard Aistleitner, Revierleiter im Vogelrevier des Zoo Heidelberg. Sein Team kümmert sich neben zahlreichen Vogelarten unter anderem um die Zwergotter und Gürtelvaris. Zwergotter sind sehr kommunikativ und verwenden eine Vielzahl von Lauten wie Pfiffe, Schreie und Brummen. So halten sie die Familie zusammen, rufen nach den Jungen oder warnen vor Gefahren.
Noch verbringen die fünf Jungtiere viel Zeit mit Schlaf, doch die Neugier auf das Leben außerhalb der Wurfkiste wächst von Tag zu Tag. Mit etwas Glück können Besucher des Zoo Heidelberg den Otternachwuchs schon jetzt durch die Scheibe mit Blick auf den geschützten Innenbereich beobachten. In wenigen Wochen wird es dann auch auf der Außenanlage wuselig, wenn Eltern und Jungtiere gemeinsam im Wasser toben.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Große Freude im Zoo Heidelberg: Bei den seltenen Berberlöwen gibt es Nachwuchs. Am Sonntag, 25. August 2024, brachte Löwin Binta zwei Jungtiere zur Welt. Eines lag leblos neben der Löwin. Das überlebende Junge stellt einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der bedrohten Unterart dar, die in der Wildbahn bereits seit rund 100 Jahren ausgestorben ist. Besucher müssen sich jedoch noch etwas gedulden, bis sie den Nachwuchs sehen können. Das Raubtierhaus bleibt noch einige Tage geschlossen. Mutter und Welpe sollen ihre Bindung ungestört aufbauen können.
Es herrscht Ruhe im Raubtierhaus. In die Stille dringt ab und an ein leises Schmatzen. Das Jungtier drückt sich eng an seine Mutter, saugt und lässt sich säubern. Berberlöwin Binta (16) hatte sich vergangene Woche immer häufiger zurückgezogen und nach einem geschützten Ort gesucht. Das Tierpflegeteam und die Zoo Handwerker hatten eine gemütliche Wurfbox eingerichtet. Doch als die Tierpfleger am Montag früh das Raubtierhaus betraten, hatte sich die Löwin für einen anderen Platz entschieden und im geschützten Bereich der Innenanlage zwei Jungtiere zur Welt gebracht. Eines von ihnen war leider tot.
„Wir konnten anfangs die Anzahl nicht klar erkennen, wir hörten nur das leise Saugen und sahen, dass Binta zwar erschöpft war, aber sich gut um das Junge kümmert“, berichtet Revierleiterin Bianca Weißbarth. „Wir schauen regelmäßig vorbei, ob alles in Ordnung ist. Binta macht das super!“
Dr. Klaus Wünnemann, Tierarzt und Direktor des Zoo Heidelberg, ergänzt: „Wir lassen Binta und ihrem Nachwuchs möglichst viel Ruhe und haben das Raubtierhaus für Besucher geschlossen. Erst in einigen Tagen, wenn sich die Bindung zwischen Mutter und Jungtier gefestigt hat, öffnen wir das Haus – zunächst voraussichtlich nur zeitweise – wieder für Besucher.“
Das Geschlecht des Jungtiers ist noch unbekannt. Die Erstuntersuchung durch die Zoo-Tierärztin ist erst in einigen Wochen geplant. Der Junglöwe leistet einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz, denn Berberlöwen sind äußerst selten. In ihrer Heimat Nordafrika sind sie bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts in der Natur ausgestorben. Nur geschützt in Zoos hat die Unterart bis heute überlebt. Entsprechend groß ist die Freude im Zoo Heidelberg, wenn auch noch etwas zurückhaltend. „Die ersten Tage sind für Welpen durchaus kritisch. Doch wir sind optimistisch, dass Binta die Aufzucht gut meistern wird“, sagte der Veterinär.
Binta ist eine erfahrene Löwenmutter. 2011 und 2014 hatte sie mit Chalid im Zoo Hannover bereits insgesamt fünf Jungtiere aufgezogen. Für den Zoo Heidelberg ist es der erste Löwennachwuchs seit 28 Jahren. Nach dem Tod der alten Löwen entschied sich der Zoo 2016 dafür, sich auch mit seinen Löwen aktiv im Ex-situ-Artenschutz zu engagieren – der Zucht und Bewahrung der Tiere außerhalb ihres ursprünglichen Lebensraumes. Seitdem leben Binta und Chalid in Heidelberg. „Wir haben unsere Löwenanlage 2019 nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen so konzipiert und gebaut, dass sie für eine Löwenfamilie viel Platz und zahlreiche Kletter- und Ruhemöglichkeiten bietet“, erklärte der Zoodirektor. „Wir sind gespannt, wann die kleine Familie den ersten gemeinsamen Ausflug auf die Außenanlage unternimmt. Binta entscheidet selbst, wann sie diese mit ihrem Jungen nutzen will. Die Verbindung zur Außenanlage bleibt immer geöffnet. Es kann sein, dass sie mit ihrem Jungen in den nächsten Wochen dort zu sehen ist“, so Bianca Weißbarth abschließend.
Das Foto zeigt das Löwenjunge, das sich eng an seine Mutter drücke.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen- Redaktion
Die hochbedrohten Weißscheitelmangaben im Tiergarten Heidelberg haben erneut für Nachwuchs gesorgt – ein wichtiger Beitrag für den Artenschutz. Während der junge Affe hier sicher und behütet im Kreise seiner Familie aufwachsen kann, kämpfen seine Artgenossen in Ghana und der Elfenbeinküste um ihr Überleben.
Am Morgen des 12. Juli 2024, konnten die Pfleger ein dunkel gefärbtes Köpfchen am Bauch der Mutter erkennen, es ist bereits das zweite Jungtier in der Heidelberger Gruppe Weißscheitelmangaben. Die Tierpfleger hatten die Geburt bereits erwartet, denn bei dieser Affenart lässt sich der Hormonzyklus gut an der Schwellung am Hinterteil der Weibchen ablesen.
Jeden Tag notieren die Pfleger Veränderungen des rötlichen haarlosen Bereiches und können so ziemlich sicher vorhersagen, ob ein Weibchen tragend und sogar wann die Geburt in etwa zu erwarten ist.
Überrascht vom Gruppenzuwachs zeigte sich aber der ältere Bruder des Neugeborenen. In den ersten Tagen konnte er kaum seinen Blick von dem kleinen Wesen lassen, das plötzlich seinen früheren Lieblingsplatz am Bauch der Mutter besetzte. Zu wilde Annäherungsversuche des Zweijährigen erlaubt die Mutter noch immer nicht, aber wenn das neugierige Männchen vorsichtig und behutsam vorgeht, darf er sein jüngeres Geschwister nun auch häufiger berühren.
Die Weißscheitelmangaben gehören zu den gefährdetsten Affenarten weltweit, die Weltnaturschutzorganisation IUCN stuft sie als vom Aussterben bedroht ein. Neben der Zerstörung ihres Lebensraumes wird dieser eleganten Tierart die Jagd auf Wildfleisch, das sogenannte Bushmeat, zum Verhängnis. Die langbeinigen Weißscheitelmangaben können zwar gut klettern, sie halten sich aber auch viel auf dem Waldboden auf, um hier nach herabgefallenen Früchten, Samen und Kleintieren zu suchen.
Dabei geraten sie leider, wie viele andere Tierarten auch, regelmäßig in von Wilderern aufgestellten Fallen. Das Bushmeat wird im großen Stil auf Märkten verkauft und als Delikatesse auch weltweit exportiert – ein großes Problem für viele Wildtierarten, die aufgrund des schwindenden Lebensraumes eh schon selten geworden sind.
Doch für die Weißscheitelmangaben, und auch die im gleichen Lebensraum vorkommenden noch selteneren Roloway-Meerkatzen, gibt es einen Hoffnungsschimmer. Die West African Primate Conservation Action (WAPCA), eine auf Initiative des Zoo Heidelberg gegründete Artenschutzorganisation, kämpft bereits seit zwanzig Jahren für die einzigartige Tierwelt Ghanas und der Elfenbeinküste. Erste Erfolge sind zu erkennen: Illegale Aktivitäten wie Wilderei und Holzraubbau sind in den von WAPCA betreuten Wäldern zurückgegangen.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesenWeihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
weiterlesenDrill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
weiterlesen