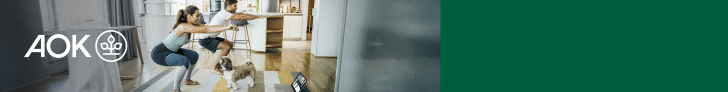- Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
- Erster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
- Süße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
- Weihnachtliche Überraschungen im Tierpark Hellabrunn: Festlich geschmückte Tannenbäume begeistern Tiere und Besucher
- Drill-Nachwuchs: Ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz
- Koala-Baby lüftet das Geheimnis seines Beutels – Einzigartige Einblicke pünktlich zu Halloween!
- Elefantenrettung mit Hightech-Medizin: Wie Akito seinen Stoßzahn (fast) verlor – und doch behielt!
- Wildtierspuren zwischen Afrika und Augsburg: Erleben Sie faszinierende Einblicke hinter die Kulissen des Artenschutzes!
- Zootag im Augsburger Zoo
- Tolle Zuchterfolge im Neunkircher Zoo
- Redaktion
„Pablo“, „Chica“ und „Bonita“: So heißen die drei Weißrüssel-Nasenbären (Nasua narica) aus der Familie der Kleinbären, die neu im Kölner Zoo leben. Die Wurfgeschwister sind am 28. Juni 2024 aus dem Opel Zoo Kronberg nach Köln gekommen. Dort bewohnen sie die ehemalige Anlage für Grizzlybären, inzwischen auch von Brillenbären genutzt, mit denen sie vergesellschaftet werden sollen. Die putzigen Tiere haben sich gut eingelebt.
„Pablo“ ist als Männchen etwas größer und schwerer als seine beiden Gefährtinnen. „Chica“ ist an der gegenüber Schwester „Bonita“ dunkleren Fellfarbe gut zu erkennen. Weißrüssel-Nasenbären erreichen eine Gesamtlänge von 80 bis 130 Zentimetern. Sie wiegen zwischen drei und fünf Kilogramm. „Pablo“, Chica“ und „Bonita“ weisen die für Nasenbären typische verlängerte und bewegliche Schnauze auf, die auf einem langestreckten Kopf sitzt.
Über und unter dem Auge sowie auf den Wangen befindet sich jeweils ein weißer Fleck. Dadurch unterscheiden sich Weißrüssel-Nasenbären von den beiden anderen Vertretern dieser Art – dem Südamerikanischen Nasenbären (Nasua nasua) sowie dem Bergnasenbären (Nasuella olivacea).
Der Weißrüssel-Nasenbär hat das nördlichste Verbreitungsgebiet innerhalb der Nasenbär-Familie. Es reicht von den südlichen USA über Mexiko und Panama bis ins westliche Kolumbien. Bevorzugter Lebensraum sind Wälder – von tropischen Regenwäldern, über Trockenwälder bis hin zu Gebirgswäldern. Sie leben sowohl auf Bäumen wie auch am Boden. Erwachsene Männchen sind teilweise nachtaktiv, in der Regel sind die Tiere im Gegensatz zu den meisten anderen Kleinbären jedoch tagaktiv. Männliche Exemplare verteidigen ihr Territorium stark gegen Artgenossen. Zu den Feinden der Weißrüssel-Nasenbären zählen verschiedene große Katzen, Greifvögel und Riesenschlangen.
Weißrüssel-Nasenbären sind Allesfresser. Vorwiegend ernähren sie sich von Insekten. Daneben zählen auch Spinnen, Skorpione, Krabben und kleine Wirbeltiere zum Speiseplan. Zudem werden Früchte und Blätter gefressen. Die Nahrung spüren sie mit der beweglichen, rüsselartigen Schnauze auf.
Lokal machen den Weißrüssel-Nasenbären Verluste ihrer Lebensräume zu schaffen. Insgesamt gilt die Art laut Weltnaturschutzunion (IUCN) jedoch als „nicht gefährdet“. Die Bestände werden als stabil eingeschätzt. Von Menschen werden Weißrüssel-Nasenbären kaum gejagt, da sie keine Schäden auf Plantagen anrichten und ihr Fell wertlos ist.
„Pablo“, Chica“ und „Bonita“ leben im Südamerikabereich des Kölner Zoos. Dort freuten sich die Zoo-Verantwortlichen 2024 bereits mehrfach über neue Bewohner: Am 19. Februar 2024 kam Zweifinger-Faultiermännchen „Jamiro“ zur Welt. Er ist im „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“ täglich gut zu sehen. Einen Neuankömmling gab es auch bei den Tapiren. Seit kurzem lebt dort der männliche Flachlandtapir-Mann „Mendoza“ zusammen mit den alteigesessenen Weibchen „Siri“ und „Rubia“.
Im Kölner Zoo herrscht insgesamt derzeit ein Baby-Boom: Jungtiere gibt es bei den Amurtigern, Asiatischen Löwen, Okapis, Bartaffen, Philippinenkrokodilen oder Erdmännchen – um nur einige zu nennen. Da lohnt ein Sommerferienausflug gleich noch mal etwas mehr.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Der Kölner Zoo freut sich, seinen neuesten Bewohner vorzustellen: den Sulawesi-Hirscheber (Babyrousa celebensis) namens „Kopa“. Diese faszinierende und gefährdete Tierart, die auf der Insel Sulawesi in Indonesien heimisch ist, bereichert ab sofort die zoologische Vielfalt unseres Zoos. Kopa, ein junger männlicher Hirscheber, wurde am 14. September 2021 im französischen Cerza geboren und hat nun sein neues Zuhause auf der Banteng-Anlage des Kölner Zoos gefunden.
Der Sulawesi-Hirscheber ist eine von drei Babirusa-Arten. Während die anderen Arten, der Molukken-Hirscheber und der Togian-Hirscheber, auf den Molukken-Inseln Buru und Sula sowie den Togian-Inseln vorkommen, lebt unsere Art ausschließlich auf Sulawesi. Mit einer Kopf-Rumpf-Länge von 88 bis 107 Zentimetern und einem Gewicht von bis zu 100 Kilogramm bei ausgewachsenen Tieren, ist Kopa ein beeindruckendes Exemplar seiner Art.
Besonders bemerkenswert sind die einzigartigen Hauer des Hirschebers: Die oberen Hauer wachsen nicht wie bei anderen Schweinen aus dem Maul heraus, sondern durchbrechen den Rüssel und biegen sich dann bogenförmig nach oben. Sie können eine Länge von bis zu 30 Zentimeter erreichen und in manchen Fällen sogar wieder in den Rüssel einwachsen. Die unteren Hauer wachsen seitlich am Rüssel vorbei nach oben. In der Wildnis brechen diese Hauer oft bei Kämpfen ab.
Ein weiteres faszinierendes Merkmal der Hirscheber ist, dass die Stellen, an denen die Hauer die Haut durchbrechen, niemals entzündliche Infektionen zeigen. Dies macht sie zu einem interessanten Forschungsobjekt für die Medizin.
Der Kölner Zoo arbeitet eng mit dem Zoo Nürnberg zusammen, der das Zuchtbuch für diese Art führt. Zudem unterstützt der Zoo die Initiative Action Indonesia, die sich für den Schutz gefährdeter indonesischer Tierarten einsetzt, finanziell und mit Expertise Action Indonesia ist eine weltweites Partnernetzwerk aus Zoos und NROs zum Schutz von Anoa, Banteng, Sumatra-Tigern und eben auch den Hirschebern. Ziel der Partnerschaft ist es, zur Erhaltung dieser Arten in situ beizutragen, um das Aussterben der Arten zu verhindern und genetisch und demografisch gesunde Ex-situ-Versicherungspopulationen zu erreichen, die zukünftige Optionen für die Wiederherstellung von Wildpopulationen bieten. Das Partnernetzwerk hat für die Hirscheber ein sogenannten globalen Arterhaltungsplan (Global Species Management Plan) erstellt. Im Rahmen des One-Plan-Approaches werden so Maßnahmen für den Schutz der Hirscheber sowohl in ihrem natürlichen Lebensraum als auch in menschlicher Obhut effektiv miteinander verknüpft.
Kopa wird auf der Banteng-Anlage leben, wo eigens ein neuer Stall für ihn gebaut wurde. Er soll mit den Bantengs und dem Prinz-Alfred-Hirsch vergesellschaftet werden. In naher Zukunft soll eine Hirscheber-Sau folgen, um hoffentlich bald Nachwuchs zu bekommen und zum globalen Arterhaltungsplan beizutragen. Hirscheber fressen Laub und herabgefallene Früchte und durchwühlen nicht wie heimische Wildschweine den Boden, was sie zu einer besonderen Bereicherung der Anlage macht.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Doppelt hält besser: Das dachte sich wohl auch der weibliche Bambuslemur „Izy“ im Madagaskarhaus des Kölner Zoos. Mitte Juni brachte sie hier zweifachen Nachwuchs zur Welt. Zwillingsgeburten sind bei den Bambuslemuren, einer madagassischen Primatenart, ausgesprochen selten. Seit es das Zuchtbuch für diese Art gibt, wurden erst einmal zuvor Zwillinge geboren.
Weltweit gibt es in Zoos nur 37 dieser Tiere. In Deutschland ist der Kölner Zoo der Einzige, der diese hochbedrohten Primaten hält und erfolgreich züchtet. Der „Doppelpack“ freut die Zooverantwortlichen daher umso mehr. Bereits in wenigen Wochen werden sich die Kleinen vom Bauch der Mutter lösen und anfangen, selbstständig auf Bäume und Äste im Madagaskarhaus zu klettern.
Mit den großen Kulleraugen und dem flauschigen Fell hat das muntere Duo eindeutig das Potenzial, einer der Sommerferienstars im Kölner Zoo zu werden. Derzeit herrscht hier ein wahrer Baby-Boom. Nachwuchs gibt es momentan u.a. auch bei Löwen, Tigern, Antilopen, Gürteltieren, Okapis oder Erdmännchen.
Das Geschlecht der beiden Jungtiere ist noch nicht bestimmt, um die Mutter-Kind-Bindung nicht zu stören. Daher haben die beiden auch noch keine Namen. Die Geburt war am 12. Juni 2024. Die zwöfjährige Mutter „Izy“, ist gebürtige Kölnerin. Sie trägt den Nachwuchs aktuell noch rund um die Uhr am Bauch. Der 20-jährige Vater „Woody“, kam vor einigen Jahren aus dem Zoo in Besançon, Frankreich, an den Rhein. Gemeinsam haben sie bereits mehrfach Nachwuchs aufgezogen. Die letzte Geburt fand vor drei Jahren statt – der männliche „Dakari“ lebt mit auf der Anlage.
Bambuslemuren erreichen eine Kopfrumpflänge von 40 bis 42 Zentimetern. Ihr Schwanz ist mit 45 bis 48 Zentimetern etwas länger als der Rumpf. Das Gewicht beträgt 2 bis 2,5 Kilogramm. Die Hinterbeine sind als Anpassung an die springende Fortbewegung leicht verlängert. Das Fell ist relativ unauffällig in Braun- oder Grautönen gefärbt. Der Kopf ist rundlich, die Ohren sind klein und abgerundet. Die Tiere sind extreme Futterspezialisten und fressen nahezu ausschließlich Bambus, worauf auch ihr Name zurückzuführen ist. Für den Kölner Zoo ist es sehr aufwendig, die benötigten großen Mengen Bambus zu besorgen. Zoo-Mitarbeiter rücken regelmäßig zu den Zoo unterstützenden Privatleuten aus, um dort frischen Bambus zu schneiden.
Bambuslemuren leben ausschließlich in zwei kleinen Regenwaldgebieten im Norden und Osten Madagaskars. Sie sind dämmerungsaktiv, leben zumeist in Bäumen, können aber auch auf den Boden kommen. Bambuslemuren leben in Gruppen von drei bis fünf Tieren. Zu den Familienverbänden zählen ein Männchen, ein bis zwei Weibchen und die dazugehörigen Jungtiere. Nach 150-tägiger Tragzeit bringen wildlebende Weibchen zwischen Oktober und November meist ein Jungtier zur Welt. In Zoos kommt es v.a. im Frühsommer zu Geburten. Das Jungtier wird mit rund acht Monaten (wenn das Nahrungsangebot am größten ist) entwöhnt. Bambuslemuren sind mit zwei Jahren geschlechtsreif.
Durch die Zerstörung ihrer Lebensräume sind die Großen Bambuslemuren in der Wildnis auf nur noch wenige 100 Tiere zusammengeschrumpft. Dementsprechend wichtig ist es, die Tiere in Zoos zu vermehren, um die Art auf der Erde erhalten zu können. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft den Großen Bambuslemuren als „vom Aussterben bedroht“ (Critically Endangered) ein. In Deutschland ist der Kölner Zoo der einzige Zoo, der diese Art hält und erfolgreich züchtet.
Maßnahmen, um den „Artenschatz Madagaskar“ zu bewahren
Der Kölner Zoo engagiert sich massiv für den Erhalt der einzigarten Tier- und Pflanzenwelt Madagaskars. Die Insel hat sich vor etwa 170 Millionen Jahren von Afrika abgespalten. Durch die isolierte Entwicklung ist eine einmalige Flora und Fauna entstanden – ein wahrer Artenschatz. Viele Tiere und Pflanzen kommen nur hier vor. Etliche Arten haben sich so stark spezialisiert, dass sie nur in begrenzten Zonen leben. Umso dramatischer wirkt sich die Zerstörung der Lebensräume durch z.B. Abholzung aus. Vielfach sterben Arten aus, bevor sie überhaupt entdeckt werden. Der Kölner Zoo ist führend verantwortlich für die Gründung der „Madagaskar Fauna & Flora Group“, einem Zusammenschluss internationaler Experten, die ganz konkret Artenschutzprojekte in Madagaskar vorantreiben. Zudem hat der Zoo bewusst jüngst viele seiner neuen Nachzuchtprojekte auf hochbedrohte madagassische Arten konzentriert.
Der Kölner Zoo unterstützt außerdem ganz konkret ein Schutzprojekt für die Großen Bambuslemuren. Er fördert den madagassischen Projektpartner „Helpsimus“ finanziell. Bei dem Projekt werden Schutzmaßnahnahmen für den Lebensraum der Tiere umgesetzt sowie Entwicklungs- und Bildungsprojekte in den benachbarten Dörfern durchgeführt. Zudem wird die Wild-Population wissenschaftlich überwacht.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Ende Mai 2024 ist im Hippodom des Kölner Zoos eine weibliche Sitatunga-Antilope zur Welt gekommen. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger haben ihr den Namen „Tamika“ gegeben. Auf Kisuaheli bedeutet dies so viel wie „die Süße“. Mutter ist die elfjährige „Suri“, die 2014 aus der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen nach Köln kam.
Sie ist eine sehr erfahrene Mutter. „Tamika“ ist bereits ihr elftes Jungtier. Der achtjährige Vater „Voldemort“, kam im Jahr 2017 aus dem englischen Chessington Zoo an den Rhein. Er hat bereits zwölfmal Nachwuchs gezeugt. Mehr als 50 Sitatungas kamen im Kölner Zoo, der 1983 mit der Haltung dieser Art begann, zur Welt.
Nah am Wasser lebend, aus West-Afrika stammend
Sitatungas, auch als Wasserkudu, Sumpfbock oder Sumpfantilope bekannt, sind Paarhufer. Sie zählen zur Familie der Hornträger (Bovidae). Der Lebensraum dieser Antilopenart erstreckt sich entlang der Flüsse und Seen des zentralen bis westlichen Afrikas. Die südlichsten Vertreter kommen im Okavango-Delta des nördlichen Botswana vor. Die Weibchen dieser Art sind leuchtend rotbraun bis kastanienbraun.
Sie tragen an der Seite und an den Flanken weiße Querstreifen und Sprenkel. Ausgewachsene Männchen sind zottelig. Die Färbung ist grau- bis schokoladenbraun. Männliche Tiere tragen ein Gehörn, das eine Länge von annähernd einem Meter erreichen kann. Mit 50 bis 100 Kilogramm Körpergewicht und einer Schulterhöhe von 80 bis 100 Zentimetern haben sie als Erwachsene eine recht imposante Erscheinung.
Die Tiere leben in der Regel in Haremsgruppen mit mehreren Weibchen und einem Bock. Sitatungas werden mit weniger als einem Jahr geschlechtsreif. Weibchen können alle neun Monate ein Jungtier gebären. Die Tragzeit beträgt im Mittel 250 Tage. Beide Geschlechter haben besonders lange und weit spreizbare Hufe. Diese sind perfekt auf ihren sumpfigen Lebensraum abgestimmt, um ein Einsinken zu verhindern. Die Sitatungas verbringen ihr Leben in den Papyrus-Dickichten rund um Sümpfe, Seen und Flüsse. Sie sind gute Schwimmer und können sogar tauchen. Nahrung sind Schilf und alle Arten von Wasserpflanzen.
Zu den Fressfeinden gehören große Katzen wie Löwen oder Leoparden, Nilkrokodile sowie Riesenschlangen. Momentan werden Sitatungas, die in vier Unterarten eingeteilt werden, zwar von der Internationalen Naturschutzunion (IUCN) als „nicht bedroht“ geführt, aber die Populationen in freier Wildbahn nehmen durch Bejagung und Lebensraumzerstörung stetig ab. Die Populationen in Togo und Niger sind wahrscheinlich bereits ausgerottet. Die Westafrikanische Population, von denen die Vorfahren der Kölner Tiere abstammen, ist am stärksten gefährdet.
Kontrollierte Erhaltungszucht für gesunde Bestände
Die in den Zoologischen Gärten Europas gehaltenen Tiere gehören alle der westlichen Unterart an, die bereits in einigen Teilen ihres Verbreitungsgebiets ausgerottet wurde. Das Europäische Zuchtbuch (ESB) für diese Unterart wird vom Kölner Zoo geführt. Derzeit sind etwa 400 der ausgesprochen grazilen Tiere in über 52 Zoos in Europa verzeichnet. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie man durch enge Kooperation zwischen den Zoos einen gesunden Bestand aufrechterhalten kann.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Das ungewöhnliche Trio ist auf dem Mittleren Weiher im Zoo gut für Zoogäste zu sehen. Der Nachwuchs ist Ende Mai 2024 geschlüpft.
Aufgrund von Umbauarbeiten an der Trompetenschwan-Anlage ließen es die Vogelexperten des Zoos bei den Schwarzschwan-Pflegeeltern erfolgreich ausbrüten. Auch die Aufzucht läuft nach Plan. Die Schwarzschwan-Adoptiveltern haben das Kleine, dessen Geschlecht noch nicht bestimmt ist, wie ein eigenes Junges angenommen und kümmern sich sehr gut. Der Nachwuchs hat derzeit noch ein gräuliches Gefieder. Es wird sich allmählich weiß färben.
Erfolgreiche Schutzmaßnahmen haben die Art erhalten
Trompeterschwäne stammen aus der Gattung der Schwäne und zählen zur Familie der Entenvögel. Ihren Namen verdanken die weiß gefiederten Vögel den trompetenähnlichen Rufen, den ausgewachsene Tiere ausstoßen. Die Vögel stammen ursprünglich aus Nordamerika.
In den 1930er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war die Art stark vom Aussterben bedroht. Massive Schutzmaßnahmen, an denen sich auch Zoos beteiligten, trugen dazu bei, dass sich die Wildbestände auf heute schätzungsweise wieder knapp 25.000 Individuen erholt haben.
Größten Schwäne der Erde
Der Trompeterschwan ist mit 150 bis 180 Zentimetern Körperlänge und etwa 2,10 Metern Flügelspannweite der größte Schwan der Erde. Mit seinem weißen Gefieder und den schwarzen Beinen und Füßen ähnelt er anderen Schwanenarten der Nordhalbkugel. Trompeterschwäne ernähren sich hauptsächlich von Wasserpflanzen.
Gelegentlich tauchen sie mit ihrem Kopf unter Wasser und suchen nach Nahrung. Im Winter fressen sie auch Gras und Getreide auf den Feldern. Jungtiere werden zunächst mit Insekten und Schalentieren gefüttert. Nach einigen Monaten wechselt der Nachwuchs zu pflanzlicher Nahrung.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
An allen fünf Kölner Spieltagen der Europameisterschaft 2024 wird das Maskottchen des 1. FC Köln, Geißbock Hennes IX., als Kölner EM-Orakel in seinem „Kleinen Geißbockheim“ im Kölner Zoo die in Köln stattfindenden Partien vorhersagen:
Die Vorhersagen des beliebten Maskottchen finden an folgenden Tagen jeweils um 10:00 Uhr statt:
• Samstag, 15. Juni 2024: Ungarn gegen Schweiz
• Mittwoch, 19. Juni 2024: Schottland gegen Schweiz
• Samstag, 22. Juni 2024: Belgien gegen Rumänien
• Dienstag, 25. Juni 2024: England gegen Slowenien
• Sonntag, 30. Juni 2024: Achtelfinale (1B gegen 3A/D/E/F)
Hennes hat dabei die Wahl zwischen verschiedenen, mit Futter gefüllten Bällen, die mit den entsprechenden Landesflaggen sowie einem Symbol für „Unentschieden“ gekennzeichnet sind. Hennes IX. hat sein Amt als Maskottchen des 1. FC Köln im Jahr 2019 übernommen.
Der Bock der Rasse „Bunte Deutsche Edelziege“ wurde am 24. Februar 2018 auf dem Biolandhof -Dörmann in Petershagen-Ilse (bei Minden) geboren und lebt seit August 2018 im Kölner Zoo. Er war bereits Teil der ersten Kölner Werbekampagne „Wir sind Gastgeberstadt“ zur UEFA EURO 2024 im Jahr 2021.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Den am 19. April 2024 im Kölner Zoo geborenen zwei Amurtiger-Jungtieren geht es weiterhin sehr gut. Ihre 13-jährige Mutter „Katinka“ versorgt die Kleinen vorbildlich. Sie füllte die Mutterrolle von Anfang an optimal aus. Es ist ihr erster Wurf. Die Jungtiere sind proper und wohlgenährt. Sie trinken derzeit noch ausschließlich Milch, die Tierpflegerinnen beginnen aber, ihnen auch Fleischstückchen anzubieten.
Die Jungtiere halten sich in den von außen nicht einsehbaren Backstage-Bereichen der Tigeranlage auf und brauchen noch viel Ruhe. Hier erweitern sie Stück für Stück ihren Radius und werden immer aktiver. Ihr achtjähriger Vater „Sergan ist separiert vom Nachwuchs und oft für Gäste auf der Außenanlage zu sehen. Auch „Katinka“ verlässt zunehmend häufiger die hinteren Bereiche und geht auf die Außenanlage.
Jungtiere wahrscheinlich im Juli 2024 zu sehen
Die Tierpflegerinnen haben immer noch keinen Kontakt zu den Jungtieren, um die sensible Mutter-Kind-Bindung nicht zu stören. Daher sind auch die Geschlechter der beiden noch nicht bestimmt. Dies erfolgt bei der ersten Impfung. Sie steht Mitte Juni 2024 an. Nach weiteren vier Wochen folgt die zweite Impfung. Dann sind die beiden jungen Amurtiger grundimmunisiert und können aller Voraussicht nach auch auf die Außenanlage. Der Zoo schätzt, dass die beiden kleinen Tiger Mitte Juli 2024 dort für die Gäste zu sehen sind. Der Zoo gibt den exakten Zeitpunkt vorher bekannt.
Erste Tiger-Geburt seit 11 Jahren – wichtiger Nachzuchterfolg
Es ist die erste Tigergeburt im Kölner Zoo seit elf Jahren. Der Amurtiger, auch Sibirischer Tiger genannt, kommt im Amur- und Ussuri-Gebiet des russischen Fernen Ostens, nahe der Hafenstadt Wladiwostok, vor. Nach einem katastrophalen Rückgang dieser Tiger-Unterart auf nur noch etwa 50 Tiere im Jahr 1940 haben sich die freilebenden Bestände durch konsequente Schutzmaßnahmen wieder auf rund 500 erhöht.
Auch im angrenzenden Nordostchina regenerieren sich die Bestände des Amur-Tigers langsam. Ihnen droht aber, wie allen Tigern weltweit, weiterhin die Ausrottung durch Lebensraumzerstörung, Bejagung ihrer natürlichen Beute und – vor allem – der Wilderei zur Verwendung in der traditionellen chinesischen Heilmedizin, wo jedem Tiger-Körperteil eine heilende Wirkung zugesprochen wird.
Inzwischen schätzt man den Gesamtbestand freilebender Tiger auf nur noch etwa 4.500 Tiere. Wissenschaftlich geführte Zoos leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Tiger durch koordinierte Zuchtprogramme. Dazu zählt zum Beispiel das seit 1985 ins Leben gerufene Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP). In ihm werden momentan 240 Amur-Tiger in 100 Haltungen koordiniert. Auch durch die Aufklärung der weltweit jährlich 700 Millionen Zoobesucher, das Sammeln von Spenden in Höhe von jährlich rund 6 Millionen US-Dollar und die Bereitstellung von Fachwissen und aktiver Hilfe versuchen Zoos, dem Tiger zu helfen.
Der Kölner Zoo hat eine Live-Cam installiert, mit der die Gäste in die Wurfbox blicken können. Den Monitor mit dem Live-Cam-Bild finden Zoo-Gäste in der „Tigerhöhle“ zwischen Löwen- und Tigeranlage.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Sie zählen zu den anmutigsten, interessantesten und seltensten Tieren der Erde: Okapis, die 1901 erstmals in den Tiefen des kongolesischen Regenwaldes für die Wissenschaft entdeckt wurden. Anfang April kam im Kölner Zoo mit dem Bullen „Hakara“ Nachwuchs bei dieser besonderen Spezies zur Welt. Sein Name bedeutet auf Swahili so viel wie „schnell“. Denn seine Geburt ging rasch von statten.
Mutter „Hakima“, 17, ist sehr erfahren und hat bereits sechs Jungtiere zur Welt gebracht. Vater ist der fünfjährige Zuchtbulle „Qenco“. Es ist sein zweiter Nachwuchs. Die Kölner Okapi-Gruppe umfasst nun vier Tiere. Im Januar zog „Imani“, Tochter von „Hakima“, auf Empfehlung des Zuchtbuchführers in den Zoo nach Frankfurt. Neben den Eltern lebt noch „Kijana“, Vollbruder von „Haraka“ in der Gruppe, was besonders gut für die Sozialisation ist.
Okapis zählen zu den Giraffenartigen. Sie werden auch „Waldgiraffen“ genannt. Die Tiere haben eine Schulterhöhe von 135 bis 160 Zentimeter. Männchen sind kleiner und leichter als Weibchen, allerdings tragen nur sie zwei spitze, hautbedeckte Knochenzapfen auf der Stirn. Wie die eigentlichen Giraffen, so haben auch die Okapis eine lange, blaue Zunge, die bis zu 25 Zentimter ausgestreckt werden kann, um Nahrung zu greifen oder das Fell zu säubern. Einzigartig ist ihre schwarz-weiße Streifenzeichnung an Vorder- und Hinterläufen, die an Zebras erinnert.
Streng geschützt, äußerst selten: Zoos engagieren sich für den Erhalt
Okapis leben meist als Einzelgänger im dichten Unterholz und auf Lichtungen des afrikanischen Regenwalds in einem eng begrenzten Gebiet im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. Es gibt keine feste Paarungszeit. Die Jungtiere, die wie Giraffen eine Stehmähne haben, liegen in den ersten Lebenswochen ab und folgen erst danach der Mutter. Okapis sind mit zwei bis drei Jahren geschlechtsreif. Der natürliche Feind der Okapis ist der Leopard.
Das Okapi ist laut den Gesetzen des Kongo streng geschützt und ein nationales Symbol. Auf der Roten Liste der IUCN wird das Okapi als „stark gefährdet“ eingestuft. Es gibt keine verlässlichen Zahlen über das Vorkommen der Okapis in der Wildnis. Die Bestände nehmen ab. Lebensraumzerstörung ist eine große Bedrohung für die Okapis, ebenso wie die Jagd auf sie für Fleisch und Fell. Eine große Bedrohung für die Okapis ist außerdem auch die Präsenz von bewaffneten Gruppen in und in der Nähe von Schutzgebieten, die Naturschutz behindern und Wilderei und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen unterstützen.
Der Kölner Zoo unterstützt seit vielen Jahren die Gilman Foundation, die das Okapi Conservation Project koordiniert. Ziel dieses Projektes ist es, mit dem Okapi Wildlife Reserve ein natürliches Waldgebiet zu erhalten. Dort werden Wildhüter ausgebildet und ausgestattet, Infrastrukturen zum Schutz von Habitat und Wildtieren aufgebaut und die Bevölkerung wird in Bezug auf nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, alternativer Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion unterstützt. Das Internationale Zuchtbuch dieser Art wird in Antwerpen geführt. In Europa leben derzeit 83 Okapis in 26 Zoos.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Das Elternpaar, das seit Februar 2023 im Kölner Zoo lebt, hat sich bestens eingelebt und sorgt nun für seinen Nachwuchs. Die beiden Elterntiere kamen im Alter von jeweils knapp einem Jahr aus den Zoos Karlsruhe und Landau nach Köln und sind nun zwei Jahre alt.
Die beiden Jungtiere, ein Männchen und ein Weibchen, haben sich in den ersten drei Wochen prächtig entwickelt. Azara-Agutis sind bereits bei der Geburt behaart und sogenannte Nestflüchter – das bedeutet, dass sie innerhalb einer Stunde nach der Geburt laufen können. Dieses schnelle Entwickeln macht sie besonders faszinierend zu beobachten.
Die Eltern und ihre Jungen teilen ihr Zuhause im kleinen Südamerikahaus mit den farbenprächtigen Hyazinth-Ara-Papageien. In dieser harmonischen Wohngemeinschaft fühlen sich unsere Azara-Agutis augenscheinlich sehr wohl.
Die Zoobesucher sind herzlich eingeladen, das Familienleben der Azara-Agutis aus nächster Nähe zu beobachten. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, mehr über diese faszinierenden Tiere zu erfahren und ihre bemerkenswerte Entwicklung mitzuerleben.
Azara-Agutis (Dasyprocta azarae) sind faszinierende Tiere mit vielen interessanten Eigenschaften. Hier sind einige spannende Informationen über sie:
• Verbreitung: Azara-Agutis sind in Südamerika heimisch, dort im Osten und Südosten Brasiliens, in Paraguay und im nördlichen Argentinien.
• Lebensraum: Sie bevorzugen tropische und subtropische Wälder, kommen aber auch in Sekundärwäldern und in der Nähe von landwirtschaftlichen Flächen vor.
• Körpergröße: Azara-Agutis haben eine Körperlänge von 40 bis 64 cm und einen kurzen Schwanz von etwa 2,5 Zentimeter.
• Gewicht: Ihr Gewicht variiert zwischen 1 und 4 Kilogramm.
• Fell: Sie haben ein dichtes, meist braunes bis rötliches Fell, das ihnen hilft, sich in ihrem natürlichen Lebensraum zu tarnen.
• Aktivitätsmuster: Azara-Agutis sind tagaktive Tiere, die den Großteil ihres Tages mit der Nahrungssuche verbringen.
• Ernährung: Ihre Ernährung besteht hauptsächlich aus Früchten, Samen und Nüssen. Sie sind bekannt dafür, Nahrungsvorräte zu vergraben, die sie später wieder ausgraben, was zur Verbreitung von Pflanzen beiträgt.
• Sozialverhalten: Sie leben meist paarweise oder in kleinen Familiengruppen und sind territorial. Sie markieren ihr Territorium mit Duftstoffen aus speziellen Drüsen.
• Reproduktionszyklus: Die Tragzeit der Azara-Agutis beträgt etwa vier Monate. Weibchen können mehrere Würfe pro Jahr haben.
• Schutzstrategien: Azara-Agutis sind sehr wachsam und reagieren schnell auf potenzielle Gefahren. Sie fliehen in dichtes Unterholz oder in von anderen Tieren gegrabene Baue.
• Kommunikation: Sie kommunizieren durch eine Vielzahl von Lauten, darunter Warnrufe, wenn sie eine Gefahr wahrnehmen
• Samenverbreitung: Durch ihr Verhalten, Samen zu vergraben und nicht alle wiederzufinden, tragen sie zur Verjüngung und Verbreitung von Pflanzen in ihrem Lebensraum bei.
• Nahrungskette: Als Pflanzenfresser sind sie ein wichtiger Teil der Nahrungskette und dienen als Beute für größere Raubtiere wie Greifvögel und Wildkatzen.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Es kam am 12. April 2024 zur Welt. Mutter ist die bereits 13-jährige „Laetitia“, die 2023 aus dem Zoo Leipzig nach Köln gezogen ist. Es ist schon ihr 15. Jungtier. Vater ist der fünfjährige „Fietje“. Er lebt seit 2019 im Kölner Zoo. Es ist sein erstes Jungtier.
Das Geschlecht des Nachwuchses ist noch unbestimmt. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger können es erst ermitteln, wenn sich das kleine Kugelgürteltier von unten behutsam auseinanderfalten lässt. Dementsprechend hat das Jungtier auch noch keinen Namen. Der Zoo zeigt Kugelgürteltiere im 2021 eröffneten „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“. Es beherbergt mittel- und südamerikanische Tiere und ist einem Dschungel nachempfunden, den die Zoo-Gäste über einen Mittelsteg durchlaufen können.
Kugelgürteltiere, auch Dreibinden-Gürteltiere genannt, leben in trockenen sowie offenen bis baumbestandenen Landschaften in Südamerika. Biologen unterscheiden Nördliche und Südliche Kugelgürteltiere. Der Kölner Zoo hält das Südliche Kugelgürteltier.
Art ist bedroht – die Bestände sind rückläufig
Die Art erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von 21 bis 31 Zentimetern. Der kurze, kräftige und dreieckig geformte Schwanz wird 5 bis 8 Zentimeter lang. Das Gewicht liegt bei 1 bis 2 Kilogramm. Der Kopf besitzt eine charakteristisch dreieckige, an den Seiten abgerundete Stirnplatte aus kleinen Knochenschildchen. Anhand dieser Stirnplatte können die beiden Arten unterschieden werden. Beim Südlichen Kugelgürteltier besteht die zweite Reihe im zentralen Abschnitt aus jeweils einem, beim Nördlichen Kugelgürteltier aus jeweils zwei Knochenplättchen.
Der markante Rückenpanzer ist sehr hart und hoch sowie deutlich gerundet. Er besteht aus einem festen Schulter- und Beckenbereich. Sie sind getrennt durch typischerweise drei bewegliche Bänder. Der gesamte Panzer ist ebenfalls aus kleinen, in der Regel fünf- bis sechseckigen Knochenschildchen aufgebaut. Die Grundfarbe der Tiere ist dunkelbraun. Sie sind bis auf wenige Haare auf der Unterseite ohne Fellkleid. Die kurzen Gliedmaßen tragen an den Hinterfüßen jeweils fünf Zehen, die in bogenartigen Grabkrallen enden. Das Südliche Kugeltier trägt drei bis vier Zehen mit besonders langen Krallen an den Vorderfüßen.
Auf dem Speiseplan der Gürteltiere stehen hauptsächlich Insekten, zum Teil aber auch Pflanzen. Als einzige Vertreter der Gürteltiere können sie sich im Bedrohungsfall zu einer Kugel zusammenrollen. Südliche Kugelgürteltiere gelten laut Weltnaturschutzunion als „gefährdet“. Obwohl sie durch ihren Panzer vor manchen Fressfeinden gut geschützt sind, ist ihr Bestand in den letzten Jahren stark rückläufig, vor allem aufgrund des Lebensraumverlusts durch Brandrodung und Plantagenwirtschaft.
Kugelgürteltiere leben normalerweise als Einzelgänger. Sie sind nachtaktiv, können aber bei Bedarf auch tagsüber erscheinen. Sie gelten als schlechte Gräber, legen aber manchmal eigene Baue an. Darüber hinaus verwenden sie verlassene Unterschlupfe anderer Tiere oder ziehen sich zum Schlafen in dichte Vegetation zurück. Manchmal findet man mehrere Tiere im selben Versteck untergeschlüpft. Bei Bedrohung flüchten Kugelgürteltiere meistens oder rollen sich komplett zu einer Kugel zusammen, was nur Vertreter dieser Gattung können. Dafür verbergen sie die Beine im Inneren und die harte Oberseite des Kopfs und des Schwanzes bilden den Verschluss. Anfänglich bleibt noch ein kleiner Spalt offen, erst bei Berührung schnappt die Kugel zu. In dieser Position können Gürteltiere kaum von Fressfeinden geöffnet werden.
Nach rund 120-tägiger Tragzeit kommt im Ursprungsgebiet meist zwischen Oktober und Januar ein einzelnes Jungtier zur Welt, das etwa 70 bis 100 Gramm wiegt. Nach rund zwei bis drei Monaten wird es entwöhnt. Geschlechtsreif sind sie im Alter von neun bis zwölf Monaten. Die Lebenserwartung liegt bei zwölf bis 15 Jahren, in Zoos können Kugelgürteltiere ein Alter von bis zu 30 Jahren erreichen
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Der Kölner Zoo hat kürzlich die drei Ende Januar 2024 geborenen Asiatischen Löwen der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie sind ab sofort regelmäßig zusammen mit der zehnjährigen Mutter „Gina“ auf der Außenanlage des Kölner Löwen-Bereichs für die Zoo-Gäste zu sehen.
Es handelt sich um zwei Männchen und ein Weibchen. Die Männchen heißen „Mani“ und „Nilay“, das Weibchen „Laya“. Vater ist der achtjährige Kater „Navin“. Zoo-Kurator Dr. Alexander Sliwa: „Es ist der jeweils erste Nachwuchs für ,Gina‘ und ,Navin‘. Beide gehen toll mit der Situation um, vor allem die Mutter hat ihre Rolle sehr gut ausgefüllt. Diese Nachzucht ist ein großer Erfolg für uns und unsere Katzenhaltung.“
In den ersten Wochen nach der Geburt verblieb der Nachwuchs in der Wurfhöhle bei Mutter „Gina“. Wie auch in der Wildnis, brauchen Löwenjunge zunächst sehr viel Ruhe, da sie noch wenig entwickelt und somit verletzlich sind. Nach und nach erweiterten die drei ihren Radius bis zum Vorgehege. Vergangene Woche erhielten die Jungtiere die letzte von zwei Impfungen. Die Grundimmunisierung ist damit abgeschlossen – eine weitere wichtige Voraussetzung für den Gang auf die Außenanlage, die sie immer mutiger erkunden.
Das Gewicht der Jungtiere beträgt jeweils rund 14 Kilogramm. Sie sind proper und ausgesprochen fit. Als Nahrung nehmen die drei immer noch beinahe ausschließlich Milch zu sich. Parallel fangen sie an, sich für Fleisch zu interessieren. Es sind die ersten Löwenjungtiere im Kölner Zoo seit 20 Jahren. Der Zoo hält seit rund 25 Jahren Asiatische Löwen. Mit dem neuen Nachwuchs erblickten nun insgesamt 18 Jungtiere am Rhein das Licht der Welt, letztmals im Jahr 2004.
Löwen, inklusive der Löwen in Afrika, sind inzwischen als Art von der Weltnaturschutzunion (IUCN) auf der Roten Liste als „gefährdet“ (vulnerable) geführt. Die letzten der einst weit verbreiteten Asiatischen Löwen haben sich im Gir Nationalpark, gelegen im nordwestindischen Bundestaat Gujarat, gehalten. Dort schützte man die um das Jahr 1920 noch 20 bis 50 verbliebenen Tiere effektiv. Diese Population war die Basis für die nun inzwischen wieder rund 600 Löwen im Gir Wald-Ökosystem und die insgesamt 150 Asiatischen Löwen des Erhaltungszuchtprogramms (EEP) in europäischen Zoos.
Auch in unmittelbarer Nachbarschaft, auf der Anlage für die ebenfalls hochbedrohten Amurtiger, freuen sich die Verantwortlichen des Kölner Zoos über Nachwuchs. Hier kamen am 19. April zwei Jungtiere zur Welt. Für sie gilt in den ersten Lebensmonaten dasselbe wie für den Löwennachwuchs: strikte Ruhe in der Wurfhöhle bei Mutter „Katinka“. Der Zoo hat eine Video-Kamera installiert, mit der Gäste live in die Wurfhöhle blicken können. Der Standort ist in der sogenannten „Tigerhöhle“ zwischen Löwen- und Tigeranlage.
Wer kleine Löwen sehen und gleichzeitig die Attraktionen des „Bauern- und Handwerkermarkts“ erleben will, ist am kommenden Sonntag, 5. Mai, Kölner Zoo genau richtig. Der Aktionstag steigt zum sechsten Mal. Rund um den Clemenshof begrüßen dann nicht nur Tiere, sondern auch Kölner Wochenmarkthändler die Gäste – von Obst- und Gemüseanbietern über Blumen- und Kräuterhändler bis zum Käsespezialisten (teilweise Bio-Herkunft). Wer direkt probieren will, ist bei Knödel- und Reibekuchenstand willkommen.
Hinzukommen Handwerker-Stände, an denen Spinnerin, Schuhputzer und Seifenhersteller ihr Handwerk zeigen und Waren anbieten. Wer sich für naturnahe Kunst begeistert, kann dem „Waldmaler" Wolfgang Schieffer über die Schulter schauen, der Totholz für einen guten Zweck bemalt. Auch biologisches Wissen wird vermittelt – die Zoopädagogik hat sich spannende Extras einfallen lassen. Für Kinder gibt es Infostände zu bedrohten Haustierrassen sowie Spiel-und Bastelstationen, an denen viel ausprobiert werden kann – von „Melkenüben“ bis Wollefilzen. Außerdem kommt ein Schafscherer und verpasst den Moorschnucken auf dem Clemenshof den Frühlingsschnitt.
Wie kommt die Marmelade ins Glas, welches Gemüse stammt aus der Region und was benötigt man für rheinische Rievkooche. Diese und viele weitere Fragen werden bei den mehrmals am Tag stattfindenden Kinder-Kochkursen beantwortet. Natürlich wird auch gekocht und gegessen. Kostenlose Anmeldungen direkt am Kochstand.
Auf einen Blick:
• Der Bauernhoftag findet am Sonntag, 5. Mai 2024 von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt.
• Es gilt der reguläre Zooeintrittspreis.
• Tipp: Der Einkauf kann während des Aufenthalts im Zoo in Stofftaschen kühl bei den Mitarbeiterinnen des Wochenmarktes abgestellt werden – und vor dem Verlassen des Zoos entspannt wieder abgeholt werden.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Mutter ist die 16-jährige „Luca“. Es ist ihr fünftes Fohlen. Der Vater heißt „Vandan“. Es ist sein viertes Jungtier. „Vandan“ kam 2017 im Zoo in Prag zur Welt. Er lebt seit vier Jahren im Rahmen des Europäischen Erhaltungsprogramms (EEP) als Zuchthengst in Köln.
Die Herde umfasst nun insgesamt sieben Tiere. Zoo-Gäste können den Wildpferdnachwuchs besonders gut von den Terrassen und Anlagen des „Chiperman‘s“-Imbiss beobachten. Das Spiel-, Genuss- und Relax-Areal mit Strandkörben und Holzwellenliegen hatte der Zoo 2023 eröffnet.
Die kraftvollen Przewalskipferde sind auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion als „endangered“ (stark gefährdet) gelistet. Zoos sind schon lange für den Erhalt dieser Wildpferdeart aktiv. Voran gingen die Biologen des Kölner Zoos, die Pionierarbeit als „Artenretter“ leisteten. Mehr als 30 Jahre managten sie das Erhaltungsprogramm für die Przewalskipferde. Sie koordinierten u.a., dass neue Bestände im riesigen Reservat Hortobagy in der ungarischen Puszta sowie komplett frei umherziehende Wildbestände in der Mongolei und in China aufgebaut werden konnten.
Przewalskipferde sind damit das Paradebeispiel für die Rettung eines Wildtieres, das ohne den Einsatz von Zoos nicht überlebt hätte. Bereits 1969 war diese Art im natürlichen Verbreitungsgebiet, den Trockensteppen der Mongolei und Chinas, ausgestorben. Seit 1992 existieren die von Köln aus angeschobenen Wiederansiedlungsprojekte. In der Mongolei und in China ziehen mittlerweile wieder auf fünf Populationen aufgeteilte Wildpferde durch die Steppen und Halbwüsten.
Alle gehen auf in Menschenobhut gezüchtete Tiere zurück. Drei bis vier Stuten werden im Schnitt pro Jahr aus europäischen Zoos allein in die Mongolei gebracht, um dort die wiederangesiedelten Bestände zu stützen. Der Populationstrend wächst insgesamt wieder. Experten gehen derzeit von 180 in der Wildnis lebenden Przewalskipferd-Paaren aus. Auch im ungarischen Nationalpark Hortobagy ziehen die Przewalskipferde frei umher. Seit 27 Jahren unterstützt der Kölner Zoo das Schutzprojekt in Ungarn je nach Bedarf mit Tieren zur Auswilderung, Geld oder biologischem Know-how.
In der Wildbahn verlassen beide Geschlechter die Geburtsgruppe im Alter von ein bis zwei Jahren. Junghengste und von stärkeren Konkurrenten abgelöste Haremshengste bilden Junggesellengruppen. Darüber hinaus kommen auch einzeln lebende Hengste vor. Im Alter von fünf bis sieben Jahren versuchen sie, eine Stute im Kampf mit Haremshengsten zu übernehmen oder aber mit umherziehenden Jungstuten eine neue Gruppe zu bilden.
Die Streifgebiete der Gruppen überlappen sich, es werden keine Territorien verteidigt. Wesentliche Bestandteile dieser Streifgebiete sind ausreichend Grasnahrung und permanente Wasserstellen. Auch im Rahmen des EEPs werden Junghengste nach ein bis zwei Jahren in einer Hengstgruppe untergebracht, wo sie im Kampfspiel die geschlechtstypischen Verhaltensweisen einüben können. Jungstuten werden vielfach ebenfalls für einige Jahre in Stutenherden untergebracht.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Der Baby-Boom im Kölner Zoo hält an! Am Morgen des Freitag, 19. April 2024 wurden dort zwei Amurtiger geboren. Mutter ist die fast dreizehnjährige „Katinka“, die Ende Juli 2023 aus dem Tiergarten Nürnberg nach Köln kam. Dort hatte sie 2015 einen Wurf erfolgreich großgezogen. Vater ist der achtjährige Kölner Kater „Sergan“, der schon wenige Wochen nach ihrer Ankunft gut mit „Katinka“ harmonierte, sodass es mehrfach zu Paarungen kam.
Dr. Alexander Sliwa, Kurator im Kölner Zoo: „Wir sind außerordentlich glücklich über den besonderen Zuchterfolg bei dieser hochbedrohten Art. Wir hatten ,Katinka‘ eigens aus Nürnberg nach Köln geholt. Das geschah in der dringenden Hoffnung auf baldigen Nachwuchs, da sie bisher nur einen Wurf vor acht Jahren hatte und unbedingt noch einmal in höherem Alter züchten sollte. Sie ist für das Zuchtprogramm genetisch besonders wertvoll. Der Plan ist aufgegangen.“
„Katinka“ ist mit den beiden Jungtieren bis auf weiteres in der für Zoo-Gäste nicht einsehbaren Wurfhöhle hinter den Kulissen. Sie füllt die Mutterrolle bislang sehr gut aus, sodass der Zoo vorsichtig optimistisch hinsichtlich der weiteren Aufzucht ist. Erst mit acht bis neun Wochen wird der Zoo das Geschlecht der Jungtiere bei der ersten Impfung bestimmen können. Mutter „Katinka“ bleibt bis auf weiteres allein und in kompletter Ruhe mit dem Nachwuchs in der Wurfhöhle.
Aus diesem Grund ist auch die angrenzende Schauanlage aktuell ohne Tiger-Besatz. Grund ist, dass Vater „Sergan“ oft an den Schieber der Wurfhöhle schlägt und der Zoo Störungen von Mutter und Jungtieren in den ersten Tagen unbedingt vermeiden will. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger haben keinen Kontakt zum Wurf, um den Aufbau der Mutter-Kind-Beziehungen nicht zu stören.
Mit einer in der Box installierten Kamera bleibt der Kölner Zoo dennoch auf dem Laufenden über alle Entwicklungen. Gäste können dieses Live-Bild mit den Jungtieren ebenfalls sehen als Extra-Angebot auf dem Monitor an der „Tigerhöhle“, die sich zwischen Löwen- und Tigeranlage befindet. Der Kölner Zoo plant, die Jungtiere bei gutem weiteren Verlauf in zwei bis drei Monaten, nach Absolvierung aller notwendigen Impfungen, der Öffentlichkeit vorzustellen. Der genaue Termin steht noch nicht fest und ist abhängig von der weiteren Entwicklung. Tiger-Junge brauchen in der Anfangszeit sehr viel Ruhe. Es ist die erste Tigergeburt im Kölner Zoo seit elf Jahren.
Der Amurtiger, auch Sibirischer Tiger genannt, kommt im Amur- und Ussuri-Gebiet des russischen Fernen Ostens, nahe der Hafenstadt Wladiwostok, vor. Nach einem katastrophalen Rückgang dieser Tiger-Unterart auf nur noch etwa 50 Tiere im Jahr 1940 haben sich die freilebenden Bestände durch konsequente Schutzmaßnahmen wieder auf rund 500 erhöht. Auch im angrenzenden Nordostchina erholen sich die Bestände des Amur-Tigers langsam. Ihnen droht aber, wie allen Tigern weltweit, weiterhin die Ausrottung durch Lebensraumzerstörung, Bejagung ihrer natürlichen Beute und – vor allem – der Wilderei zur Verwendung in der traditionellen chinesischen Heilmedizin., wo jedem Tiger-Körperteil eine heilende Wirkung zugesprochen wird.
Inzwischen schätzt man den Gesamtbestand freilebender Tiger auf nur noch etwa 4.500 Tiere. Wissenschaftlich geführte Zoos leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Tiger durch koordinierte Zuchtprogramme. Dazu zählt zum Beispiel das seit 1985 ins Leben gerufene Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP). In ihm werden momentan 240 Amur-Tiger in 100 Haltungen koordiniert. Auch durch die Aufklärung der weltweit jährlich 700 Millionen Zoobesucher, das Sammeln von Spenden in Höhe von jährlich rund 6 Millionen US-Dollar und die Bereitstellung von Fachwissen und aktiver Hilfe versuchen Zoos, dem Tiger zu helfen.
Amurtiger sind Publikumsmagneten im Kölner Zoo. Der Zoo hat 2020 gemeinsam mit Kooperationspartner WWF den für rund 2 Millionen Euro aufwendig modernisierten Bereich für Amurtiger eröffnet. Die Anlage wurde vergrößert und die Haltung zum Beispiel durch zusätzliche Separierungsmöglichkeiten und den Einbau einer Trainingswand, an der die Tierpfleger mit den Tieren Beschäftigungsprogramme durchführen können, weiter optimiert.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen- Redaktion
Der Baby-Boom im Kölner Zoo geht weiter – mit einer Geburt bei den Bartaffen im Urwaldhaus des Kölner Zoo: Die 15-jährige „Medini“ hat dort Mitte März 2024 ein männliches Jungtier zur Welt gebracht. Es ist noch namenlos. Vater ist der zwölfjährige „Obi“. Der Kleine entwickelt sich optimal und ist bereits gut für die Gäste zu sehen.
Die Kölner Bartaffengruppe umfasst damit nun insgesamt sechs Tiere: Neben „Obi“, „Medini“ und dem neuen Nachwuchs leben noch die zweijährige „Mayuri“ – ebenfalls Tochter von „Medini“ und „Obi“ – sowie die beiden neu eingezogenen Weibchen „Sirsi“, 13, und „Indira“, 14, auf der Anlage.
„Sirsi“ und „Indira“ kamen Mitte Dezember 2023 aus dem Howletts Wildlife Park in der britischen Grafschaft Kent nach Köln. Sie sollen künftig für weiteren Nachwuchs bei dieser stark bedrohten Primatenart sorgen. Die Tiere sind tagsüber alle zusammen auf der vor wenigen Jahren neugestalteten Anlage im Urwaldhaus des Kölner Zoos zu sehen.
Wer den Kölner Zoo am kommenden Sonntag besucht, kann nicht nur jede Menge Jungtiere, sondern auch die Angebote und Zusatz-Aktionen des „KlimaTag“ genießen. Gezeigt wird dabei, wie bunt und vielfältig Klimaschutz sein kann. Zahlreiche Partner aus der Region geben Tipps, wie man im Alltag Energie sparen, nachhaltiger essen oder mobil unterwegs sein kann. Zooexperten informieren anschaulich darüber, wie sich die Klimaveränderungen auf die Tierwelt auswirken.
Bartaffen zählen zur Gattung der Makaken. Ihre Ursprungsregion ist Südwest-Indien. Die Art ist stark bedroht: Lebensraumzerstörung, Wilderei und der Straßenverkehr machen ihr schwer zu schaffen. Nur noch 2.500 ausgewachsene Tiere werden laut Schätzungen der Weltnaturschutzunion IUCN in ihrem Heimatgebiet vermutet. Bartaffen pflanzen sich aufgrund später Geschlechtsreife und langen Geburtsintervallen nur langsam fort. Somit erholen sich dezimierte Populationen leider schlecht. Der Kölner Zoo setzt sich besonders für die Bewahrung von Bartaffen ein, denn der Zoo führt das international koordinierte Erhaltungsprogramm für diese Art.
Bartaffen leben in größeren Gruppen, die sich im Freiland aus einigen Männchen und vielen Weibchen zusammensetzen. Das Fell der Bartaffen ist meist schwarz. Herausragendes und namensgebendes Merkmal ist die silberweiße Mähne rund um Kopf, Wangen und Kinn. Mit einer Kopfrumpflänge von 40 bis 60 Zentimetern und einem Gewicht von drei bis zehn Kilogramm zählen Bartaffen zu den kleineren Makaken, wobei die Männchen allerdings deutlich schwerer als die Weibchen werden. Bartaffen ernähren sich in erster Linie von Früchten. Zusätzlich fressen sie Blätter, Knospen, Insekten und kleine Wirbeltiere.
Meistgelesene Meldungen:
- Katzenhasser unterwegs? Kater kommt mit Schussverletzung nach Hause
- In Tierklinik transportiert: Wer hat das Pferd so schwer verletzt?
- Vermehrtes Stechmückenaufkommen nach dem Hochwasser
- Erstmals Hundeschwimmen im Städtischen Freibad
- Unbekannter verletzt Kater schwer
- Mehrere hundert Fische in Privatweiher getötet
- Babykatzen bei minus 9 Grad ausgesetzt
- Polizei verhindert unerlaubten Katzenverkauf
- Gefahr für Mensch und Tier
- 24-Jähriger lässt sterbendes Reh am Straßenrand liegen
Das könnte Sie auch interessieren:
Neuer Mähnenrobbenbulle Lío bereichert den Zoo Heidelberg
weiterlesenErster Nachwuchs 2026: Shetlandpony-Fohlen begeistert im Zoo
weiterlesenSüße Weihnachtsüberraschung: Nachwuchs bei Zwergseidenäffchen
weiterlesen